Chronik von Seewalchen
| Die Chronik der Jahre ... |
|---|
1851-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 | 1921-1940 | 1941-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 |
Aus der Chronik der Marktgemeinde Seewalchen am Attersee. (Übersicht)
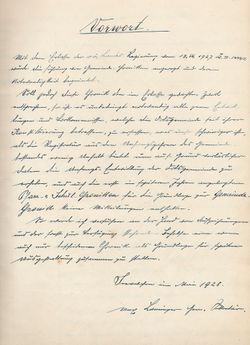
Vorwort
1927 regte das Land Oberösterreich an, in den Gemeinden Chroniken zu führen. So begann im Mai 1928 der Gemeindesekretär Max Laminger mit Aufzeichnungen.
Lamingers Verdienst war es, auch die Zeit ab 1850, dem Gründungsjahr der Gemeinde, aufzuarbeiten. Er verwaltete die Chronik nach seiner Pensionierung (1938) bis zum Jahr 1964 weiter. Schon 92-jährig übergab er sie dann an den damaligen Amtsleiter Josef Nöhmer.
Josef Nöhmer ergänzte die Aufzeichnungen durch Bilder und Fotos, so dass die Chronik zu einem großartigen Geschichtsbuch von Seewalchen wurde.
1971 wies Regierungsrat Leo Schreiner gegenüber Nöhmer auf einige Lücken der Chronik hin, die er trotz Würdigung der langjährigen und gewissenhaften mühevollen Führung anmerkte. So ergänzte Schreiner auf Ersuchen Nöhmers im Herbst 1971 die Gemeindechronik.
Schreiner war seit 1895 mit kurzen Unterbrechungen jeden Sommer und nach seiner Pensionierung 1956 die meiste Zeit des Jahres in Seewalchen. Aufgrund seiner Erinnerungen und Aufzeichnungen und mithilfe einschlägiger Behelfe ergänzte er die Chronik „aus der Sicht des Sommergastes“. Neben den Ergänzungen verfasste er längere Zusammenfassungen und schrieb diese in das erste handgeschriebene Chronikbuch.
Mit der Pensionierung Nöhmers 1975 begann sein Nachfolger Rudolf Romankiewicz an der Chronik mitzuarbeiten, nach dem Tod Nöhmers 1992 auch der ehemalige Leiter der Hauptschule, Johann Rauchenzauner. Mit dem Tod Johann Rauchenzauners 2021 beendete auch Rudolf Romankiewicz seine Archivarbeit.
Im AtterWiki wird ein Auszug der Texte der Chronik von Seewalchen allgemein zugänglich gemacht. Häufig wird der Originaltext verwendet, gelegentlich werden die Eintragungen durch andere Schriften ergänzt oder es sind Erläuterungen angefügt.
Die Aufzeichnungen dieser Chronik erfolgten durch Laien - die sehr bemüht - was wichtig erschien, in diese Chronik zu schreiben. Die Möglichkeiten von umfangreichen Recherchen, gerade was ältere Aufzeichnungen anlangt, sind aber begrenzt. Und die Eintragungen sind weder vollständig noch können sie einem wissenschaftlichen Anspruch genügen.
Einleitung
(Originaltext von Max Laminger)
Seewalchen = Seewalhin = Seewalhen
„Dem Laciakum der Römer seit dem Jahre 1135 dem Stifte Michaelbeuern einverleibte Pfarre, waren auch die Orte Chemata = Kemating, Einwahlhesdorf = Ainwalchen, Polperc = Buchberg, seit dieser Zeit einverleibte Orte.
Im Jahre 1337 erteilte Konrad von Schaunberg dem Stift Michaelbeuern wegen der Pfarre Seewalchen das Fischrecht am Attersee. 1530 verlieh Kaiser Ferdinand I. dem Franz von Kufstein einige Güter, Gütlein und Untertanen zu Lehen aus der Pfarre Seewalchen.
Bei den Bauernaufläufen 1626-1632 hatte die Pfarre und Herrschaft Seewalchen sehr viel zu leiden.
Im Jahre 1731 starb in Seewalchen der berühmte Odilo von Gunrath als Administrator.
Die Kriegsjahre 1800, 1805 und 1809 brachten auch der Pfarre Seewalchen empfindlichen Schaden.”
In der „Ergänzung zur Chronik“ widerspricht Leo Schreiner (1971) der weitverbreiteten Ansicht, dass Seewalchen das römische Laciacum ist und führt aus, dass es sich dabei um einen Ort in der Gegend zwischen Frankenmarkt und Hörading handeln musste. Diese Ansicht dürfte auch richtig sein.
1850 Errichtung der Ortsgemeinde
(Originaltext von Max Laminger)
- Durch das Gesetz vom 17. März 1849 wird die Konstituierung der Ortsgemeinde beschlossen. Mit Erlass vom 13. Februar 1850 ordnet die o.ö. Statthalterei in Linz die Durchführung dieses Gesetzes unter Berücksichtigung der Zusammenlegung bereits bestehender Katastralgemeinden an. Nach einem Rundschreiben vom 14. Februar 1850 sollten die Katastralgemeinden Hainbach, Kammer, Oberachmann, Litzlberg, Seewalchen, Steinbach, Weyregg und Aurach zusammengeschlossen werden. Dieser Plan kommt jedoch nicht zur Durchführung.
- Am 4. August 1850 beschließt der damalige Gemeindeausschuss die Selbständigkeit der Ortsgemeinde Seewalchen durch Vereinigung der Katastralgemeinden Litzlberg und Seewalchen. Dieser Beschluss wird auch in der Folge aufrecht erhalten.
Ortsgemeinde Seewalchen
- Die Ortsgemeinde Seewalchen umfasst 1661 Seelen (Seewalchen: 945, Litzlberg: 716),
- Die Deckung von Abgaben erfolgt durch Umlagen auf direkte Steuern bzw. durch Zulagen auf direkte Steuern.
- Gewählt wird in 3 Wahlkörpern.
der erste Bürgermeister war Anton Peyr, Papiermüller in der Au-Pettighofen (heute Marktgemeinde Lenzing),
1. Gemeinderat: Franz Holzinger, Bauer in Haining 5,
2. Gemeinderat: Mathias Gugg, Gastwirt in Seewalchen 29. - Aus der am 24. August 1850 begonnenen öffentlichen Rechnung der Ortsgemeinde ist zu entnehmen, dass ein Peter Stadler als Polizeimann mit monatlich fl. 10.--, eine Anna Stadler als Hebamme mit monatlich fl. 2.-- und ein Wegmacher namens Duftschmied mit monatlich fl. 3.-- bestellt wurden.
- Nach einer Rechnung des Tischlers Kratzer kostet ein Sarg samt Kreuz fl. 1.20 xr.
- Im September 1850 wird um Bewilligung um Abhaltung eines jährlichen Viehmarktes angesucht, es sind jedoch keine Dokumente einer Bewilligung vorhanden.
Jedoch ist in alten Kalendern ein Kirchweihfest am Jakobitag (25. Juli) verzeichnet, wurde jedoch in späteren Jahren wieder aufgelassen.
| Chronik der Marktgemeinde Seewalchen |
|---|
1850 - Beginn der Aufzeichnungen - Übersicht 1851-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 |
Die Jahre 1851 bis 1860
1851 und 1852.
- Auf die direkten Steuern werden 10% Umlage eingehoben. Die Umlagen bestehen aus Pfarr-, Schul-, Gemeinde- und Armenumlagen. Dem Pfarrsprengel sind einverleibt aus der Gemeinde Berg die Ortschaften Baum, Brandham und Rubensdorf, aus der Gemeinde Timelkam die Ortschaften Arnbruck, Ulrichsberg und Thal.
Armenpflege
(Originaltext von Max Laminger)
Bis zum Jahre 1880 war der Wirkungskreis der Armenpflege nicht die Ortsgemeinde sondern die Pfarrgemeinde. Die gebräuchlichste Art der Armenversorgung für vollständig Erwerbsunfähige war die Armeneinlage in Natura - Verpflegung von Haus zu Haus. In der Gemeinde wurde die Naturaleinlage im Jahre 1896 aufgelassen. Der letzte Einleger war ein gewisser Kliemstein, von Beruf Schleifer, welcher infolge seiner Unreinlichkeit und seines boshaften Charakters eine Hauptursache war, dass von dieser mittelalterlichen Einrichtung in der Gemeinde Seewalchen Abstand genommen wurde. Die Trennung des Armenfondsvermögens der Pfarrkirche erfolgte 1881 durch Teilung der Ortsgemeinden Seewalchen und Berg.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1852 (24.8.1850-31.12.1852): Einnahmen: fl. 1238.33 xr. Ausgaben: fl. 1162.30 xr. (fl. = Gulden, xr = Kreuzer)
1853
- Infolge der Aufhebung der Untertans- und Zehentleistung waren an die Herrschaften Ungenach zu Kammer-Puchheim, an den Amthof Seewalchen, Pfarrhof Seewalchen, Pfarrhof Schörfling und Straßwalchen und das Weissenburgeramt von den ehemaligen Untertanen Ablösungsbeträge zu leisten, welche von einigen Besitzern die Höhe von über fl. 200 erreichten, und im Jahre 1853 noch ziemliche Rückstände waren, sodass, wie aus Rechnungen ersichtlich, die Exekutionsorgane sehr viele in Einquartierung lagen. Deren Löhne und Verpflegung musste von den rückständigen Parteien aufgebracht werden.
1855
- Gemeindevorsteher 1855-1858: Franz Holzinger, Bauer in Haining Nr. 5.
- Mit Circularerlasse vom 12.7.1855 des Kreisvorstandes Wels wird die Regierungsverordnung vom 13.7.1786 betreff Verbot „blauer Montage“ für Gesellen und Lehrlinge bei fl. 10,-- Strafe im Betretungsfalle in Erinnerung gebracht.
1856
- Die Pfarrgemeinde Seewalchen erhält eine neue Glocke laut Rechnung des Glockengießers Franz Oberascher in Salzburg um den Betrag von fl. 121.--.
1857-1860
- Gemeindevorsteher 1858-1861: Anton Hofmann, Brauereibesitzer in Litzlberg 14.
- Kaiserliches Patent über die Bestimmungen des Münzwesens. Nach fast 100 Jahren geht Österreich von der Conventionswährung ab.
Die Überrechnung beträgt: 100 fl. C.W. = 105 fl. ö.W. (ö.W. = österreichische Währung). - Die Elisabeth-Westbahn von Linz nach Salzburg wird gebaut.
Die Jahre 1861-1870
1861
- Gemeindevorsteher 1861-1864: Johann Reibersdorfer, Schneidermeister in Seewalchen Nr. 50 (Hauptstr. 11).
- Am 30.7.1860 wird Karl Streicher als Gemeindebeamter mit mon. 7 fl. und Johann Idlhammer als Gemeindediener mit 6 fl. bestellt.
1862
- Der schadhafte Dachstuhl des Kirchturmdaches wird ausgebessert, das Dach wird mit Lärchenschindeln eingedeckt und mit Blech verkleidet. Kirche und Turm werden neu angeworfen. Die Gesamtkosten betragen 2160 Gulden. Am 11. August 1862 werden Kugel und Kreuz wieder aufgerichtet.
(Seit diesem Jahr werden Urkunden in die Kugel unter dem Kreuz gegeben.)
1863
- Aus unbekannter Ursache brennen am 19.12.1863 die Häuser Nr. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14 und 38 in Steindorf vollständig nieder.
Rückblick
(Originaltext von Max Laminger)
Seit dem Jahre 1850 als der Zwang der Robot und der Zehent aufgehoben, die Konstituierung der politischen Gemeinde beschlossen und die Gemeinde Seewalchen mit dem Sitz des Gemeindeamtes in der Ortschaft Seewalchen mit den umliegenden 17 Ortschaften errichtet war, waren 13 Jahre verflossen, ohne dass von den 1850 bestandenen 68 Häusern nur um 1 Haus vergrößert wurde oder eine merkliche Veränderung an den meist mit Lagerdachung versehenen Häusern zu bemerken war. Das Seeufer des Attersees war an keiner Stelle längs der Ortschaft von den einschlagenden Wellen bei Sturmwetter geschützt und es war kein Weg am Ufer erkennbar.
Die einheimische Bevölkerung des Ortes sowie der Gemeinde, an den alten Vorurteilen ihrer Eltern stur hängend, konnte es nicht einfallen andere Verhältnisse herbei zu führen und selbst das Stift Michaelbeuern nach dem großen Brand des Amthofes im Jahr 1860 war nur bestrebt, den Amthof und das Wirtschaftsgebäude nebst die großen landwirtschaftlichen Gründe wieder lebensfähig zu machen und sich um die vernachlässigten Verhältnisse nicht zu kümmern. Obwohl durch Einheirat und notwendige Ergänzung der Gewerbetreibenden ein kleiner Zuzug von Fremden, von den Einheimischen als „Zugroaste“ bekannt, wohl die Absicht hatten, bessere Verhältnisse herbei zu führen, konnte das Misstrauen der Alteingesessenen sowie der Umstand, dass die Fremden erst nach zehnjährigem, ununterbrochenen Aufenthalte die Heimatberechtigung in der Gemeinde erlangen konnten - mussten sie ihre berechtigten Wünsche, eine Vergrößerung und eine Verschönerung des Ortes zu erreichen mit der Hoffnung auf spätere und längere Jahre zurückstellen und auch die übrigen Ortschaften des Attersees die gleichen Ansichten hatten.
________________________________________________________________________________________________________
1864
- Inventar der Gemeinde:
- 1 weicher Tisch: fl. 2,--
- 2 weiche Sessel: fl. 2,--
- 1 Schriftenkasten: fl. 6.--
- Schreibzeug: .30 xr.
- Siegel und Farbe: fl. 3.--
- Gesetzblätter und Bücher: fl. 4.--
- Gemeindemappe auf Papier: fl. 5--
- zusammen: fl. 22.30 xr.
- Straßenschanzzeuge:
- 1 Sandgitter: fl. 3.--
- 1 eiserne Schaufel: .50 xr.
- 1 Krampen: .70 xr.
- 1 Kotscherer: .30 xr.
- 1 Steinhammer: .30 xr.
- zusammen: fl. 9.80 xr.
- Summe der Fahrnisse (bewegliche Güter) : fl. 32.10 xr.
- Im Jahre 1864 wird das Feuerwehrwesen an Hand der Gemeindeordnung im Gesetz verankert.
- Jagdpacht: 50 fl. jährlich; Jagdpächter Felix von Pausinger, Herrschaftsbesitzer in Kogl.
1865
- Es wurden folgende Entschädigungen beschlossen:
Bürgermeisterbesoldung pro Jahr: fl. 72.--
Kanzleimiete im Haus Seewalchen Nr. 50: fl. 20.--
Gemeindebeamter monatlich: fl. 7.--
Gemeindediener monatlich: fl. 6.--
Fleischbeschauer jährlich: fl. 30.--
Nachtwächter jährlich: fl. 10.--. - 15.7.1865: Beim Bauerngute des Karl Hausjell, Seewalchen 48 (Moserbauer), entsteht ein Brand, welchem das ganze Objekt zum Opfer fällt.
Nur durch die Windstille und die aufopfernde Beihilfe der Bewohner ist es möglich, die umliegenden Häuser Nr. 29, 49 und 47 zu retten.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1865: Einnahmen: fl. 1103.33 xr. Ausgaben: fl. 701.06 xr.
1866
- Nach dem Tode des Schulleiters Josef Streicher wird Johann Mayr als Schulleiter der einklassigen Volksschule ernannt (1866-5.9.1872).
Die Witwe nach dem verstorbenen Josef Streicher erhält eine von der Gemeinde geleistete Pension von 80 fl. jährlich. - Es wird beschlossen, für Verwundete der Gemeinde eine Sammlung zu veranstalten und zur unentgeltlichen Heilung in Pflege zu übernehmen.
- Im Jahre 1866 wird die Gemeinde Seewalchen vom Hagelschlag betroffen.
- Im Jahre 1866 brennt das Haus Nr. 6 in Gerlham ab.
1867
- Im Jahre 1867 hat die Ortschaft Seewalchen 68 Häuser.
- 19.6.1867: Kaiser Maximilian von Mexiko, ein Bruder Kaiser Franz Joseph I., wird in Querétaro erschossen.
Der spätere Besitzer der Insel Litzlberg, Baron Eduard Springer, war der ständige Begleiter des Kaisers Maximilian in Mexiko. - 28.8.1867: Als Nachtwächterpauschale werden jährlich fl. 10 bewilligt.
1868
- 16.8.1868: Der Brandschaden-Versicherungs-Verein der Pfarrgemeinde Seewalchen wird gegründet und mit 1. Jänner 1866 rückwirkend. Ab April 1868 werden die Prämien eingehoben.
Der Obmann des Vereines ist Anton Hofmann, Brauer in Litzlberg Nr. 14. - 31.10.1868: Die Erteilung des Ehekonsens aufgrund des Ehekontraktes seitens der Gemeinde wird aufgehoben.
Bis dahin konnte die Gemeinde die Zustimmung zu einer Ehe verweigern, wenn kein Verdienst oder keine Arbeit nachweisbar war, die Sitten verletzt wurden oder Krankheit vorlag. - 31.12.1868: Über behördliche Verfügung muss ein Gemeindearrest beschlossen werden und wird bei Michael Idlhammer, Seewalchen Nr. 47, mit jährlich fl. 12.-- Zins zu diesem Zwecke ein Lokal gepachtet.
- Amthofverhalter und Pfarrer P. Gregor Mödlhammer lässt die Pfarrkirche restaurieren.
1869
- 27.6.1869: Es wird beschlossen, das Eigentumsrecht des Attersees zu behaupten und keinen Grund hievon abzuverkaufen.
- 27.7.1869: Franz Achleitner in Kraims kauft von Felix von Pausinger das Fischrecht im Steindorfer-Kraimserbach um fl. 52.50 xr.
- 28.8.1869: Es langt das erste Dampfschiff für den Attersee in Kammer ein, welches durch Schießen und Läuten feierlich empfangen wird. Es ist ein kleiner Schraubendampfer, der „Ida“ benannt wird.
1870
- Mit dem Jahre 1870 beginnt der Streit um das Eigentumsrecht des alten Schulhauses (Mesnerhaus, Kirchenplatz 2) und endet dieser Streit zu Gunsten des Stiftes Michaelbeuern im Jahre 1894.
- 1.8.1870: Bei der stattfindenden Neuwahl der Gemeindevertretung wird Josef Leitner, Bauer in Reichersberg, als Gemeindevorsteher für die Jahre 1870 bis 1873 gewählt.
- 1.9.1870: Der Archäologe Ladislaus Gundacker Graf Wurmbrand entdeckt in der Nähe des Stallinger-Anwesens (Atterseestr. 27) beim Ausfluss des Sees erstmals in Österreich Pfahlbaureste.
- Im Jahre 1870 wird die Gemeinde Seewalchen von starkem Hagelschlag betroffen. Die Kosten der Zehrung für die Schadensaufnahme sind in der Gemeinderechnung mit fl. 17.66 xr. ausgewiesen.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1870: Einnahmen: fl. 990.71 xr. Ausgaben: fl. 809.04 xr.
Die Jahre 1871-1880
1871
- Im Jahre 1871 wird das Haus Nr. 57 in Seewalchen (Christ-Villa, Promenade 5) durch Herrn Karl Rosenauer als Villa umgebaut und für den Sommeraufenthalt eingerichtet.
- Im Jahre 1871 wird infolge Sprunges einer Glocke die Anschaffung von 3 neuen Glocken beschlossen. Im Jahre 1872 erfolgt die Weihe und der Aufzug der Glocken. Diese Glocken (1037 kg, 512 kg und 318 kg) haben ein harmonisches Geläute und werden am 21.3.1917 aus Anlass der Metallsammlung für Kriegszwecke abmontiert und abgeliefert.
1872
- Johann Sompeck ist vom September bis November provisorischer und dann bis 1.6.1878 wirklicher Schulleiter. Ab Februar 1872 wird die Schule zweiklassig geführt. Als Unterlehrer wird Georg Haulbersch angestellt, er bleibt bis 1874. Die zweite Klasse ist im Pfarrhof Seewalchen mit fl. 40.-- Jahreszins untergebracht.
- 1.3.1872: Die Auflassung des Schulgeldes wird beschlossen.
- 3.3.1872: In Schörfling wird ein Gendarmerieposten, der auch für Seewalchen zuständig ist, errichtet.
1873
- Gemeindevorsteher: 1873-1876: Josef Leitner, Bauer in Reichersberg.
- Im Jahre 1873 herrscht in der Umgebung starke Blatternepedemie. Seewalchen bleibt bis auf einige unbedeutende Fälle verschont.
1874
- 1874 wird die Schmidt-Villa vollendet.
Khevenhüller-Kapelle
- Am 15.4. wird die Erbauung einer Familiengruft für die Familie Horváth-Kammer bewilligt und im gleichen Jahr erbaut.
Nachdem diese Gruft in Form einer Kapelle von der Familie Horváth nicht in Anspruch genommen wurde, wird dieselbe vom Veteranenverein 1917 als Kriegerdenkmal ausgestattet und besteht seither als solches für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg.
Aus den Prozessakten „Friedhof-Schulhausstreit“ geht hervor, dass die Mutter des Schlossbesitzers Horváth in dieser Gruft in Seewalchen begraben wurde. Die Mutter des Besitzers von Schloss Kammer Frau von Horváth ist am 6.7.1874 an Blattern verstorben. Aus unbekannten Gründen wird jedoch die Leiche nicht am Schörflinger Friedhof geduldet, weshalb das Grab über Nacht offenbleibt.
Am nächsten Tag kommt der Bote des Herrn von Horváth, namens Anton Bodenwieser, im Namen seines Herrn mit dem Ersuchen, die Leiche der Frau v. Horváth in Seewalchen bestatten zu lassen. Herr v. Horváth hat für den Fall der Zustimmung, für die Armen der Gemeinde eine größere Spende und zum Schulbau 25 Baumstämme angeboten. Vom Bürgermeister wird die Zustimmung erteilt. Über dem Grab wird schließlich die Kriegerkapelle errichtet. - Das Kriegerdenkmal wurde am 6.11.2000 abgerissen.
________________________________________________________________________________________________________
1875
- 1.2.1875: Der Attersee wird als öffentliches Gut eingestuft.
- 16.3.1875: Mit Beschluss des Gemeindeausschusses werden für ihre Verdienste wegen Freilassung des Attersees als öffentliches Gut zu Ehrenbürgern der Gemeinde Seewalchen ernannt:
Dr. Ritter von Chlumetzky, Ackerbauminister,
Dr. Karl Graf, Bezirkshauptmann in Vöcklabruck,
Dr. Adolf Dürnberger, Hof- u. Gerichtsadvokat in Linz.
Die Gemeinde wird dadurch von der Grundsteuer für den See befreit. - Im Jahre 1875 werden die Druschgemeinschaften Steindorf und Seewalchen gegründet.
(1976 beschloss der Druschverein, sein gesamtes Inventar der Frw. Feuerwehr Seewalchen zur Verwertung zu übergeben).
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1875: Einnahmen: fl. 14032.04 xr. Ausgaben: fl. 12498.16 xr.
1876
- Gemeindevorsteher 1876-1879: Mathias Holzinger, Bauer in Haining Nr. 5.
- Von 1876 - 1880 wirkt als Pfarrer P. Nikolaus Gründinger.
- Im März 1876 herrscht Hochwasser. In Attersee wird die Straße nach Seewalchen durch eine Hangrutschung verlegt.
- 8.8.1876: Der Blitz schlägt in das Mayr-Gut in Arnbruck, später Arbeiterwohnhaus der Lenzing AG, ein und äschert es ein.
- Das alte Schulhaus Seewalchen (Mesnerhaus, Kirchenplatz 2) wird nach der Fertigstellung der neuen Volksschule als Gemeindekanzlei verwendet.
- Im Jahre 1876 herrscht große Kälte. Der Attersee ist vom 12. auf 13. Februar bei 16 Grad R. (=Reaumur) zugefroren.
Schulbau
Durch die Einführung der 8-jährigen Schulpflicht erwies sich die zweiklassige Volksschule zu Seewalchen zu klein, da schon 1872/73 die Schülerzahl auf 261 gestiegen ist.
Im Oktober 1873 erging vom Landesschulrat eine Aufforderung an den Ortsschulrat, eine Kommission wegen der Errichtung eines Schulbaus zu gründen. Der Kommission wurden drei Bauplätze angeboten, da aber diese zu teuer waren, entschloss man sich das alte Schulhaus entsprechend zu erweitern. Am 12. Februar 1874 kam man jedoch mit Herrn Josef Kletzl wegen eines Schulgrundes ins Gespräch. Im Herbst des Jahres wurde der neue Schulbau in Angriff genommen, nachdem die Schulgemeinde ein unverzinsliches Landesdarlehen aus dem oberöst. Landesschulden-Tilgungsfonde im Betrag von 9500 fl. aufgenommen hatte. Dieses Kapital sollte oder musste vielmehr in 20 Raten zu 475 fl. vom Jahre 1877 an zurückgezahlt werden.
Aus der Schulchronik:
Den Bau leitete Baumeister Herr Mathias Ströbl von Schörfling... Der gesamte Schulbau kostete 15.086.76 fl, samt Einrichtung: 17.516 fl. Im Jahre 1876 gegen Ende April war der Bau soweit fortgeschritten, dass die I. Klasse daselbst untergebracht werden konnte. Für die II. Klasse wurde noch das alte Schulgebäude benützt.
Im Monate Juli wurde der Gesamtbau bis auf die Gartenanlage fertig, die Eröffnung der neuen Schule konnte vor sich gehen.
Leider ist es zu bedauern, dass eine feierliche Eröffnung des Schulhauses aus lokalen Gründen unterbleiben musste.
Dafür veranstaltete der Zweiglehrerverein Vöcklabruck gelegentlich seiner Jahresversammlung am 25. Oktober 1876 eine diesbezüglich kleine Gedenkfeier, welche in unserem Schulgebäude abgehalten wurde. Nach einem gemeinschaftlichen Mittagsmahle belebten Gesänge und Toaste verschiedener Art das gesellige Zusammensein, bis der hereinbrechende Abend die Versammlung zum Aufbruch mahnte. Zwanzig Lehrer und Lehrerinnen hatten sich eingefunden, darunter auch Gäste aus der Umgebung.
Die Vollendung des Baus wurde am 28.10.1877 dem oö. Landesamt angezeigt.
Bis 1972 war die Volksschule, dann von 1973 bis 1983 die Hauptschule und seit 1991 ist die Landesmusikschule in diesem Haus untergebracht.
1877
Villa Paulick
Friedrich Paulick (1824 -1904), k.u.k. Hoftischler, erbaute sich 1877 in Seewalchen eine Villa, die er zu einer Sehenswürdigkeit ausgestaltete.
Die Pläne stammten von den Wiener Architekten Professor Rudolf Feldschareck und Professor Karl Könige.
In der Villa baute Paulick Teile des Kaiser-Pavillons der Wiener Weltausstellung 1873, den er hergestellt hatte, als Salon ein. Ein Arbeitskabinett, das auf der internationalen Ausstellung, gleichfalls von Paulick ausgeführt, zu sehen war, diente als Bibliothek. Bauteile und das ganze Material wurde mit Pferdefuhrwerken von der Bahnstation Timelkam nach Seewalchen transportiert.
Die Baukosten betrugen, wie in der Familie erzählt wird, 80.000 fl.
Die Villa wurde von vielen Persönlichkeiten, einmal auch von Erzherzog Johann (Orth), besucht.
Nach dem Tode Friedrich Paulicks ging die Villa in den Besitz der ältesten Tochter Therese über, die später den Prokuristen Hermann Flöge heiratete.
- 1.5.1877: Dem Gemeindebeamten Mathias Holzwieser wird sein Gehalt pro Monat von fl. 17.-- auf fl. 20.-- erhöht. Für Steuereinhebung an Sonntagen werden 8 xr., an Wochentagen 6 xr. bewilligt.
Gründung der Feuerwehr
Am 2. November 1877 werden die Statuten der neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen genehmigt.
- Gründer der Frw. Feuerwehr waren:
Lehrer Johann Sompeck,
Brauer Josef Hofmann, Feuerwehrhauptmann,
Tischlergehilfe Johann Deutsch,
Bäckermeister Georg Pfeffer,
Tischlermeister Franz Köstler, Feuerwehrhauptmann-Stellvetreter.
Innerhalb kurzer Zeit gelingt die Anschaffung einer kleinen hölzernen Feuerspritze.
Es ist eine große hölzerne Spritze mit befestigtem beweglichen Stahlrohr ohne Schlauchverwendungsmöglichkeit. Die Wasserzubringung erfolgt mittels imprägniertem, leinernen Wasserkübeln. Die links und rechts der Feuerspritze angebrachten schweren Pumpstangen werden von Hand aus bedient.
________________________________________________________________________________________________________
1878
- 15.10.1878: Zum definitiven Schulleiter wird Herr Adolf Gattringer an der dreiklassigen Volksschule Seewalchen bestellt. Derselbe bleibt bis zum Jahre 1904.
1879
- Für die Periode 1879 - 1882 wird als Gemeindevorsteher Wolfgang Starzinger, Bauer in Kraims 2, gewählt, nachdem er im Dezember stirbt, wird für die restliche Periode Bernhard Aigner, Neubrunn 4, gewählt.
- 27.10.1879: Das Auszughäusl „zum Lacher Toffn“ in Roitham brennt nieder.
- Vom 1.-29. Dezember herrscht große Kälte, der Attersee ist bei 16 Grad R (=Reaumir) zugefroren.
1880

Die Villen Schmidt, Paulick und Christ sind zu sehen, das Eschenhaus steht noch nicht.
- 11.11.1880: Die öffentliche Armenpflege erfolgt nun an Stelle der Pfarrgemeinde durch die politische Gemeinde. Armenvater wird Josef Mayr, Seewalchen 49 (Koaser, Hauptstraße 7).
- Im Jahre 1879/80 tritt in den ganzen mitteleuropäischen Staaten die Krebspest auf, sodass im Jahre 1880 in allen Gewässern die Krebse aussterben. Erst durch Legen neuer Brut ist wieder ein neuer Nachwuchs entstanden, welcher jedoch an den früheren Stande nicht heranreicht.
- In diesem Jahr wird die Totenkammer auf dem Friedhof erbaut.
- Der Attersee ist im Winter 1879/1880 für 30 Tage zugefroren.
- Der Schuhmacher Franz Achleitner aus Kraims gründet den Musikverein Seewalchen.
- Im Jahr 1880 beginnt Johann Gebetsroither in Unterbuchberg mit dem Bau von Plätten.
Einige Zahlen Die Gemeinde Seewalchen hat nach dem Stande der Volkszählung 1880 insgesamt 1929 Personen.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1880: Einnahmen: fl. 4994.52 xr. Ausgaben: fl. 4080.85 xr.
| Chronik der Marktgemeinde Seewalchen |
|---|
1850 - Beginn der Aufzeichnungen - Übersicht 1851-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 |
Die Jahre 1881-1890
1881
- Im Jahre 1881 erfolgt die Trassierung wegen Erbauung der Vöcklabruck-Kammer-Bahn, wobei wegen verweigerter Grundabtretung einiger Besitzer die Enteignung erfolgt.
1882
- Gemeindevorsteher 1882-1885: Anton Stallinger, Sägemüller in Pettighofen 14.
- 16.4.1882: Mit Gemeindeausschussbeschluss wird Herr Anton Peyr, ehemaliger Papiermüller in der Au, in Würdigung seiner Verdienste als 1. Bürgermeister zum Ehrenbürger der Gemeinde Seewalchen ernannt.
Peyr war auch Abgeordneter zum Reichstag in Kremsier 1848. - 30.4.1882: Feierliche Inbetriebnahme der „k.u.k. Priv. Localbahn“ Vöcklabruck-Kammer mit einem Jubiläumszug: Wien-Kammer. Am nächsten Tag beginnt der reguläre Betrieb.
1883
- Der Amthof wird an den ehemaligen Schlossherrn von Starhemberg, Rudolf Seyrl, Haag a.H., verkauft. Wirtschaftliche Überlegungen dürften zu diesem Entschluss des Klosters Michaelbeuern geführt haben.
Einige Joch kommen zum Pfarrhof, aber zur Verbuchung ans Stift Michaelbeuern.
Der Kaufpreis beträgt fl. 32.000.-- öst. Währung.
Amthof
(Originaltext von Max Laminger)
- Der Amthof Seewalchen war im jahrzehntelangen Besitze des Stiftes Michaelbeuern, verwaltet von den jeweiligen Pfarrern der Pfarre Seewalchen, welche neben der Seelsorge für ihre Pfarrkinder nur nebenbei sich der Verwaltung des großen landwirtschaftlichen Betriebes widmen konnten, und so nach und nach ein offensichtlicher Rückgang der Erträge dieses so schönen Besitzes eintreffen musste. Alle möglichen und unmöglichen Arbeitskräfte wurden für die landwirtschaftlichen Arbeiten eingestellt, ohne Prüfung deren Leistungsfähigkeit, so wurden auch unter anderem für die Erntedruscharbeiten Drescher in langjähriger Verwendung durch die dem Amthof umliegenden Häuseln, welche infolge der langjährigen Einstellung der Besitzer als Drescherhäusl bekannt waren, eingestellt. Zur Druschzeit zogen die Drescher ihre breitgehaltenen Raschschuhe an, welche die entsprechenden Weiten und Größen hatten und begannen den Drusch mit gewohntem Pflichteifer.
- Sie konnten nicht verhindern, dass bei „eifriger Arbeit“ sich auch die leeren Stellen der Raschschuhe mit dem Getreide füllten, so dass sie gezwungen waren, sehr oft an den Druschtagen sich zu ihren Häuserln zu bemühen, um durch Entleeren und Reinigen der Raschschuhe für ihre Füße Platz zu schaffen und so ihrer Pflicht als Drescher wieder nachkommen zu können.
- Natürlich konnte man den Dreschern nicht zumuten nach Druschendigung das in ihren Häusln angesammelte Getreide, das ohne ihr Zutun sich in den Schuhen verirrte, in den Amthof zurückzubringen, sondern zum eigenen Lebensunterhalt zu verwenden. Es ist selbstverständlich, dass dieser Vorgang der Getreideverirrung nur ein kleiner Auszug der verschiedenen anderen Vorgänge, die das Erträgnis des Amthofes nicht förderten, ist, so dass das Stift Michaelbeuern beschloss, das Gut samt den zugehörigen Gründen an den Herrn Gutsbesitzer Rudolf Seyrl in Haag a. H. zu verkaufen.
- Der neue Besitzer des Amthofes schaffte sofort Ordnung durch Einstellung geschulter landwirtschaftlicher Dienstboten sowie eines tüchtigen Maurers.
- Natürlich waren durch diese Einstellungen alle früheren Angestellten einschließlich der Drescher ihrer Arbeit enthoben. Die so lange Jahre in Verwendung gestandenen Raschschuhe konnten infolge Alter keine Verwendung als Schuhbekleidung finden, so wurden dieselben zu Hühner-Legenestern zugerichtet und es soll dem Vernehmen nach den Hühnern gelungen sein, während des Eierlegens noch Körner aus den ehemaligen Raschschuhen herauszupicken.
________________________________________________________________________________________________________
1884-1885
- Im Jahre 1884 wird die Haltestelle Siebenmühlen errichtet.
- Gemeindevorsteher 1885-1888: Franz Stigler, Bauer in Kemating Nr. 7.
- Von 1885-1889 wirkt als Pfarrer P. Modest Lienbacher.
- Im Jahre 1885 ist großer Hagelschlag in der Gemeinde und werden aus dieser Ursache Steuerabschreibungen in der Höhe von fl. 1075.44 xr. seitens des Steueramtes Vöcklabruck vorgenommen.
Restaurierung der Pfarrkirche
- Mit der Restaurierung der Pfarrkirche wurde begonnen und im Jahre 1887 beendet. Die Kosten des neuen Hochaltars betrugen fl. 1400, die der Kanzel fl. 500.
- In der Chronik wurde der frühere Altar als in „Zopfstil“ [soll heißen Barockstil] erbaut bezeichnet und geschildert als ein „Konglomerat“ von hässlichen Statuen und Vasen, von wurmstichigen, von Zeit zu Zeit herabstürzenden Verzierungen und Brettern und massiven Balken. Die Seitenaltäre waren um nichts besser.
- Die Skizze zum neuen Hochaltar entwarf Kunsttischler Karl Maurer von Linz und diese wurde verbessert und abgeändert durch den Domarchitekten Otto Schirmer aus Linz. Der alte Altar wurde Ende Juni 1887 abgetragen und das mittlere Fenster ausgebrochen. Der jetzige Hochaltar wurde am 26. Juni 1887 geweiht. Die neue Kanzel stammt von Linzinger aus Linz.
- Große Wohltäter der Kirche sind an den Fenstern verewigt, zum Beispiel Theresia Schachl, Auszugbäuerin von Ainwalchen, Anton Stallinger, Kleinmüller von Siebenmühlen-Pettighofen, Anna Maria Ebetsberger, ledige Bauerntochter vom Starzbauerngute in Gerlham, der Jungfrauenbund, Theresia Paulick, Villenbesitzerin aus Wien, und ungenannte Spender. Das dritte, auf der Nordseite des Presbyteriums gelegene Fenster mit einem lieblichen Engelsköpfchen (Paulick-Fenster) wurde von der Firma Geyer in Wien hergestellt, während die übrigen von Rudolf Schadmayr in Salzburg angefertigt wurden.
- Die Herz-Jesu-Statue spendete Anna Maria Ebetsberger (Gerlham), auch im Namen ihrer Angehörigen und die „Immaculata“ die Egger-Geschwister (Steindorf).
________________________________________________________________________________________________________
- 5.5.1885: Aus unbekannter Ursache brennt das Anwesen „Bauer in Baum“ nieder.
- Im Jahre 1885 wird die Kapellermühle an der Ager versteigert. Der neue Besitzer heißt Raudaschl (seither Raudaschlmühle).
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1885: Einnahmen 1885: fl. 3078.80 xr. Ausgaben: fl. 2200.24 ½ xr.
1886
- Im September ertrinkt beim Baden im Attersee Mathias Mayr, Bauernsohn vom Koaserbauerngut. Er badete gewöhnlich unter der Bäumler-Villa und stand im Alter von ca. 80 Jahren.
Der Verunglückte hatte 50 fl. zur Kirchenverschönerung vermacht, welcher Betrag zur Anschaffung des Fensters nächst der Sakristei verwendet wurde.
1887
- 19.5.1887: Die Maria-Lourdes-Kapelle in Kraims wird eingeweiht. Der Bauernsohn Wolfgang Starzinger, gestorben am 9. Juni desselben Jahres, hat es von seinem Heiratsgute erbauen lassen.
- Im Juni 1887 brennt das Anwesen Kroiß, Ainwalchen 13, bis auf die Grundmauern ab.
- Im September 1887 brennt das Anwesen der Mathias Mühlbacher, Kraims Nr. 6, bis auf den Grund nieder.
- Friedrich Paulick lässt an Stelle eines baufälligen Bauernhauses (Nr. 54) [Botenhäusl auch Reifhaus] eine Villa, das Eschenhaus (Promenade 8) ausschließlich für Sommerwohnungen erbauen.
1888
- Gemeindevorsteher 1888-1891: Michael Aicher, Bauer in Buchberg 9.
- Im Jahre 1888 wird die Gemeinde von Hagelschlag betroffen.
1889
- Von 1889-1893 wirkt als Pfarrer P. Wolfgang Stockhammer.
- 14.1.1889: Nachts um 10 Uhr brennt das Brauhaus in Litzlberg ab. Der Brand im Brauhaus entsteht durch Selbstzündung des Malzes auf der Darre. Sud- und Wohngebäude fallen dem Feuer zum Opfer. Die Stallungen werden mit Not gerettet. Wäre rechtzeitig eine Handspritze zur Verfügung gestanden, so hätte das Brauhaus leicht gerettet werden können, da der brennende niedere Torbogen, welcher den Brand vermittelte und fortsetzte, leicht abzudämpfen gewesen wäre.
Der Sohn der Herrschaft Kammer, Husarenleutnant Anton Baron Horváth, stürzt bei einem scharfen Ritt zur Brandstatt und zieht sich eine Verletzung zu, der er aber keine Beachtung schenkt. Er hilft eifrig bei den Bergungsarbeiten mit. Wenige Tage später erliegt er einer Blutvergiftung. Sein Grab befindet sich links vom Haupteingange der Pfarrkirche Schörfling. - Im März beginnen die Aushebungsarbeiten für die Errichtung der Wirtschaftsgebäude beim Pfarrhof. Ende Juni stehen die Gebäude, aber zu klein, daher muss dann noch ein hölzerner Bau an der Straße errichtet werden.
1890
- Anfang des Jahres herrscht die „Influenza“ (Grippe), so dass in sämtlichen Häusern zu gleicher Zeit die Leute liegerhaft werden.
- 15.2.1890: Das Aberlbauerngut in Steindorf Nr. 25 brennt ab.
- Im Mai Hagel, im Juli Hagel und Wolkenbruch, am 14. August wieder Hagel.
- 22.7.1890: Ein Blitz schlägt während des sonntäglichen Hauptgottesdienstes in den Kirchturm, glücklicherweise ohne zu zünden.
- 26.7.1890: Die neue Orgel von Albert Mauracher in Salzburg wird aufgestellt und geweiht. Beim Orgelbau wird auch die Sängerempore um den vorspringenden Teil erweitert.
- 31.7.1890: Feierliche Primiz eines Pfarrkindes, des hw. Herrn Gottlieb Gebetsberger von Haining, derzeit Pfarrer in Theresienfeld in Niederösterreich.
- 1.-6.9.1890: Der Attersee tritt infolge Hochwasser an vielen Stellen aus den Ufern.
Volkszählung 1890
(aus der Pfarrchronik)
In der letzten Dezemberwoche 1890 wird durch Kooperator Pater Coelestin, Schulleiter Gattringer und Lehrer Hebmüller (?) die allgemeine Volkszählung von Haus zu Haus vorgenommen.
Ergebnis der Volkszählung: politische Gemeinde Seewalchen: 1623 (1956: 3160) von der politischen Gemeinde Timelkam gehören zur Pfarrgemeinde Seewalchen 129, und von der politischen Gemeinde Berg 125.
Die Pfarrgemeinde Seewalchen zählt also 1877 Seelen davon 70 Protestanten. (Anmerkung: 1956 waren es 368 Protestanten).
Anmerkung: Zum Vergleich zu 1956 ist zu beachten, dass sich die Gemeindegrenzen geändert
haben und viele Heimatvertriebene nach dem 2. Weltkrieg Protestanten waren.
Rechnungsabschluss des Jahres 1890: Einnahmen 1890: fl. 4905.10 xr. Ausgaben; fl. 3680.89 xr.
Die Jahre 1891-1900
1891
- Gemeindevorsteher 1891-1894: Josef Moser, Bauer in Staudach 3.
- In der Zeit vom 17. auf den 18. Jänner 1891 friert der Attersee infolge der grimmigen Kälte zu und bleibt durch 70 Tage als Eisfläche, so dass mit beladenen Fuhrwerken am See gefahren werden kann.
- 30.6.1891: Das Haus Nr. 9 des Josef Leitner in Neißing brennt um 11 Uhr nachts vollständig ab.
- Im Jahre 1891 ist starker Hagelschlag, von dem die ganze Gemeinde verhagelt wird, sämtliche Fechtung (Feldfrüchte) wird vernichtet.
Die Schloßen fallen wie Taubeneier, besonders über Kemating, Staudach, Steindorf, Roitham, Neubrunn, Haidach.
1892
- Im Februar 1892 ist großes Wasser, der Sturm verwüstet die Seewege, Herr Pfeffer Paul, Bäckermeister am See (respektive seine Frau Carolina als Witwe), verkauft das Anwesen und jetzt stehen dort die zwei Villen Lettmayr und Enstein.
- Am 22. Juni 1892 um 8 Uhr vormittags brennt das Bauershaus zu Gerlham des Josef Heistinger (vulgo Draxler) nieder.
- Am 24. August 1892 ist mit 44 Grad R [= ca. 35° C] seit 1797 der heißeste Tag.
- Im Jahre 1892 erfolgt die Gründung einer gewerblichen Kollektiv-Genossenschaft und Krankenkasse für die Gemeinde Seewalchen.
Im Jahre 1920 wird die Krankenkasse mangels der gesetzlich genügenden Mitgliederanzahl aufgelöst. - Im Jahre 1892 werden die Kaisermanöver in Seewalchen und Umgebung abgehalten.
- Im Jahre 1892/93 wird am Amthof Seewalchen durch Herrn Seyrl ein 2. Stockwerk aufgeführt und erhält hiedurch der Bau einen schlossartigen Stil.
- Im Jahre 1892 erhält die Pfarrkirche zwei neue Seitenaltäre vom Bildhauer Rifesser aus Gröden um den Preis von fl. 984.50 xr. (Teile der beiden alten Seitenaltäre werden für die Kirche in Buchberg verwendet).
- 8.9.1892: In Attersee wird der „Verband zur Hebung der Sommerfrischen am Attersee“ gegründet, dem auch der Verschönerungsverein Seewalchen beitritt.
- 21.12.1892: Im Gugg'schen Gasthaus gründen 47 Bürger den Vorschusscassenverein (Raiffeisenkasse) für die Pfarrgemeinde Seewalchen. Zum Obmann wird Carl Leiß, Kalkbrenner in Seewalchen, gewählt. Schrift- und Kassenführer ist der Lehrer Anton Stelzmüller.
1893
- 4.1.1893: Der Gemeindeausschuss stimmt der Errichtung eines Postamtes in Seewalchen nicht zu.
- Der Winter 1893/94 ist sehr streng, 10 bis 20 Grad R.
Von Mitte Jänner anhaltende Kälte, so dass der See Mitte Februar zufriert und erst Anfang April eisfrei wird. Es gibt massenhaft Schnee und Schneestürme. - Der Amthof erhält seine jetzige Ausgestaltung mit zwei Ecktürmen.
„Nordufer des Attersees“
Origialtext von Max Laminger:
Als im Jahre 1848 die Freiheitsbewegung ganz Österreich in Aufruhr brachte, hat auch Graf Khevenhüller, Besitzer des Schlosses Kammer, durch Aufstellung einer Nationalgarde in die Bewegung eingegriffen und dadurch sich die Ungnade des Kaisers und des gesamten kaiserlichen Hofes zugezogen und hiedurch auch das gesamte nördliche Atterseeufer mit samt seinen Bewohnern in Mitleidenschaft gezogen.
Als im Sommer 1893 Kaiser Franz Joseph I. mit dem rumänischen König von Weißenbach aus eine Rundfahrt am Attersee machte, durfte das Dampfschiff nur bis Steinbach fahren und musste dort Richtung Unterach wieder umkehren, damit das verpönte Nordufer nicht erreicht werden konnte. Selbst bei nicht zu umgehenden Durchfahrten des Hofes wurden die Wagen geschlossen und erst nach Passieren von Kammer durften die Wägen wieder geöffnet werden.
Anmerkungen:
- Leo Schreiner: Dieser angebliche Konflikt des Herrscherhauses mit der Familie Khevenhüller-Frankenburg konnte bisher nicht geschichtlich belegt werden.
- August Mayr [Chronist aus Schörfling]: Der Konflikt ging so weit, dass Graf Wurmbrand, der Entdecker der Pfahlbauten es nicht wagte, diese jungsteinzeitliche Epoche „Atterseekultur” zu nennen, die Bezeichnung heißt „Mondseekultur”.
________________________________________________________________________________________________________
1894
- Gemeindevorsteher 1894-1897: Mathias Wenninger, Bauer in Steindorf 2.
- 25.1.1894: Der Gemeindesekretär Josef Aicher wird über Verfügung des Gemeindevorstehers Moser wegen Differenzen in der Kassengebarung außer Dienst gestellt. Nachdem jedoch eine gerichtliche Überprüfung die Haltlosigkeit der Beschuldigung ergibt, wird derselbe im Juli 1894 rehabilitiert und wieder in Dienst gestellt.
- Von 1894-1905 wirkt als Pfarrer P. Felix Kohler.
- 28.11.1894: Mit Beschluss des Gemeindeausschusses wird Dr. Hauttmann in Kammer am Attersee als Gemeindearzt der Gemeinde Seewalchen für 3 Jahre mit jährlich fl. 230.-- bestellt.
- 20.1.1895: Der Weg längs des Attersees vom Seewirt bis Deckert (Rosenvilla, Promenade 4) wird als öffentlicher Weg erklärt.
Der Streit ums Schulhaus
Der im Jahre 1870 begonnene Streit zwischen dem Stifte Michaelbeuern und der Gemeinde Seewalchen wegen Eigentumsrecht des alten Schulhauses wurde mit Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes vom 14.2.1894 zugunsten des Stiftes Michaelbeuern entschieden und demselben das Eigentumsrecht zuerkannt.
Im Jahre 1894 erfolgte die exekutive Räumung und es wurden sämtliche Registraturakten der Gemeinde, nachdem dieselbe den Abtransport nicht rechtzeitig veranlasste, beim Fenster der im 1. Stock untergebrachten Gemeindekanzlei hinausgeworfen. Mangels einer anderweitigen Kanzlei wurden die Akte im Gasthaus Gugg (jetzt Stallinger) im Vorhause des 1. Stockes untergebracht und hiedurch wertvolle Behelfe der Registratur nicht mehr vorfindlich sind.
Papierfabrik Pettighofen
Im Jahre 1894 erfolgte die Erbauung und Inbetriebsetzung (1.8.1895 [richtig ist: 1.8.1896]) der von den Brüdern Theodor und Emil Hamburger erbauten Holzstoff- und Pappenfabrik durch Ankauf der Mühle und Säge des Anton Stallinger samt zugehörigen Gründen, somit an gleicher Stelle, an welcher die Papiermühle des Herrn Anton Peyr in der Au seit dezenium in Betrieb war, jedoch durch die Konkurrenz der maschinellen Papiererzeugung aufgelassen und in eine Sägemühle umgewandelt wurde.
Die ursprüngliche Anlage der Papierfabrik war sehr primitiv und hat sich durch die vorgekommenen großen Unfälle den Namen „Krüppelfabrik“ zugezogen, bis die Umwandlung der Betriebe Pettighofen und Lenzing in eine Aktiengesellschaft und Umbau derselben mit geeigneten Sicherheitsmaßnahmen die Unfälle verminderten.
Schloss Litzlberg
Im Jahre 1895 kaufte Herr Eduard Springer aus Wien die nächst dem Mayrgute in Litzlberg gelegene Insel von Anton Hofmann und baute auf derselben ein kleines Schlösschen. In den Folgejahren vergrößerte derselbe die Insel durch eine mit Piloten gesicherte Steinumfriedung.
Die Insel war bis zum Jahr 1780 (nach Gilbert bis 1800), in welchem die Gebäude abgetragen wurden, eine Feste mit den dazugehörigen Gebäuden des Mayrhofbauerngutes. Auch diese Gebäude wurden im Lauf der Zeit umgebaut und verkleinert.
Schon im Jahre 1315 schienen als Besitzer der Herrschaft Litzlberg die „Winder zu Windern“ auf und noch im Jahre 1606 lebte ein Wolfgang Winder von Schliemating dortselbst.
Nach einer Grabsteininschrift ist „Frau Anna Katharina Riedlin, Pflegerin zu Litzlberg, anno 1720 den 17 Marty umb ¾ auf 10 h Nacht in Gott seelisch entschlafen ihres Alters im 74-igsten Jahre“.
Nach den noch ersichtlichen Piloten führte auch in früherer Zeit vom Mayrhof zur Insel eine Brücke.
Anmerkungen:
- Angeblich wurde das Abbruchmaterial zum Wiederaufbau des abgebrannten Ortes Schörfling verwendet (Brände in Schörfling 1787 und 1828).
- Nach Erzählungen der Maria Schreiner, geb. Paulick (1865-1937), war die Insel in den Jahren 1880-1890 ein beliebtes Ausflugsziel für Ruderbootpartien. Es wurden dort sogenannte Picknicks veranstaltet, wobei Bier aus dem gegenüberliegenden Brauhause gebracht wurde. Die Insel war damals unbesiedelt, die Brücke wurde erst in späterer Zeit (1917) zum Festland gebaut.
________________________________________________________________________________________________________
1895
- 14.-16.8.1895: In Seewalchen und Umgebung finden größere militärische Übungen statt.
Rechnungsabschluss des Jahres 1895: Einnahmen: fl. 4976.57 xr. Ausgaben: fl. 4340.05 xr.
1896
- 13.6.1896: Herr Rudolf Seyrl, Amthofbesitzer in Seewalchen Nr. 1 wird mit Beschluss des Gemeindeausschusses wegen seiner Verdienste um den Ausbau der Ortswasserleitung zum Ehrenbürger der Gde. Seewalchen ernannt.
- Am 1. August 1896 wird die Papierfabrik Pettighofen in Betrieb genommen.
Diese wird 1939 geschlossen. - 5.9.1896: Infolge Blitzschlag brennt das Bauerngut Mayr in Buchberg, wobei die Wirtschaftsgebäude und die Dachung des Heustadels samt Fechsung (= Ernte) vernichtet werden.
- Im Jahr 1896 geht der Consum-Verein-Seewalchen in Konkurs (Kreisgericht Wels).
Der Verein besaß das Haus Seewalchen 27, welches nun von Anton Hackl und 1900 von Georg Kump erworben wurde. Bis 1985 wurde dort eine Gemischtwarenhandlung betrieben.
1897
- Gemeindevorsteher 1897-1900: Georg Sulzberger, Bauer in Seewalchen.
- Hochwasser
Infolge lang anhaltender Regengüsse im Sommer kommt es zu größeren Überschwemmungen in fast allen Ländern. In Vöcklabruck und in Ebensee entsteht großer Schaden.
Der Attersee ist auf Straßenhöhe beim Seewirt aus den Ufern getreten.
Die Promenade ist überschwemmt und kann mit Booten befahren werden. Im Haus Nr. 55 (Schreinerhaus, heute Promenade Nr. 7) steht das Wasser mehrere cm hoch.
Der Weizen kann erst im August eingebracht werden und wächst vor dem Schnitt auf dem Felde aus. Nach Timelkam muss die Wasserwehr der Frw. Feuerwehr Seewalchen zur Hilfeleistung. - Im Juli 1897 ist Fahnenweihe des 1894 gegründeten Mil. Veteranenvereines Seewalchen.
Obmann Josef Mahringer, Protektor Carl Leiß, Fahnenmutter Maria Leiß.
An der Fahnenweihe beteiligen sich sehr viele Vereine aus weiter Umgebung. Die Feldmesse ist am Goldberg bei schönem Wetter.
(Am 8.2.1948 muss das Vereinsvermögen infolge Auflösung des Mil. Veteranenvereins im Wege der Gemeinde abgeführt werden.) - 1897 wird der Verschönerungsverein Seewalchen gegründet.
1898
- Der Winter 1897/1898 ist sehr mild mit wenig Schneefall und im Monat März vorüber.
- Mit dem Jahre 1898 wird die Schule nach Zahlung der letzten Rate des Schulbaudarlehens per fl. 475 schuldenfreies Eigentum der Schulgemeinde Seewalchen.
1899
- Hochwasser
Das Jahr 1899 ist ein nasses Jahr und bringt dem Lande Oberösterreich große Überschwemmungen.
Vom 5. bis 15. September prasseln schwere Regengüsse herab. Der Attersee tritt aus den Ufern. Zwischen Litzlberger Keller und Scheibenhof (Moos 2) kann man auf der Straße mit Ruderbooten bequem fahren. Auch auf der Promenade kann man mit Booten fahren. Das Haus Nr. 55 (heute Promenade Nr. 7) ist überschwemmt, das Wasser steht ca. 30 cm hoch.
Die Ager wird zu einem reißenden Strom. Die Holzjochbrücke über die Ager wird weggerissen und eine „Überfuhr“ mit einem „Trauner“ eingerichtet, wofür man einige Kreuzer zahlen muss. Die Brücke wird als 3jochige Holzbrücke wieder errichtet und erst 1914 als Betonbrücke erbaut. - 10.7.1899: Im Haus Seewalchen 76 (Kirchenplatz 3) wird ein „Sommerpostamt“ in Betrieb genommen (Ganzjahresbetrieb ab April 1905).
Die erste „Postexpedientin“ war Anna Friedberger. Sie hatte ein Gehalt von 320 K. Dazu kamen 120 K Ortszulage, 40 K Amtspauschale und 744 K Dienerpauschale (vermutlich für die gesamte Saison). Die letztere erhielt sie für die Post- und Telegraphenzustellung, den Kanzleidienst, die Briefkastenaushebung und für Botengänge zum Postamt Kammer. Täglich waren 4 Botengänge vorgesehen. - Im Jahre 1899 wird der Helmbaum des Kirchturmes, nachdem dieser durch eindringendes Wasser morsch geworden war, ersetzt. Bei dieser Gelegenheit wird auf die Laterne eine 4 m hohe Pyramide aufgesetzt. Am 15. Oktober erfolgt die Kreuzsteckung.
In der Kugel unter dem Kreuz befindet sich eine Urkunde.
1900
- Gemeindevorsteher 1900-1903: Carl Leiß, Kalkbrenner, Seewalchen 66.
Die Gemeindekanzlei wird im Auszughause Nr. 42 Seewalchen (Kapellenweg 7) samt Isolierlokalitäten um eine jährliche Miete von 50 Kronen gemietet. - 12.9.1900: Die Erwerbung des Anwesens Nr. 46 (Hauptstraße 1) in Seewalchen bei der zu gewärtigenden Versteigerung wird beschlossen.
| Chronik der Marktgemeinde Seewalchen |
|---|
1850 - Beginn der Aufzeichnungen - Übersicht 1851-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 |
Die Jahre 1901 bis 1905
1901
- 22.2.1901: Der Attersee friert zu.
Am 24.2. bricht der Bodenwiesersohn aus Weyregg nächst dem Seeberg durch das Eis und ertrinkt. - 12.3.1901: In Schörfling stirbt der erste Bürgermeister der im Jahre 1850 konstituierten neuen politischen Gemeinde Seewalchen und Ehrenbürger Anton Peyr im Alter von 86 Jahren. Er wird am Seewalchner Ortsfriedhof (an der Außenseite in der Nische in der Mitte des Chores) begraben.
- 15.5.1901: Das Stiegler-Haus, Seewalchen 46 (heute Tostmann, Hauptstraße 1), samt Gründe wird um den Preis von 16.350 Kronen der Gemeinde Seewalchen zugeschlagen.
Im gleichen Jahr erfolgt die Versteigerung der Landwirtschaftsgründe, während Hausgarten, die Stieglerwiese (heute Rathausplatz bis Bocksleitnerweg) und der Wald als Gemeindeeigentum verbleiben.
Das Haus wird zum Gemeindeamt umgebaut. - 20.8.1901: Die Freiwillige Feuerwehr Kemating wird gegründet.
1902
- 27.5.1902: Katharina Schiemer, Seewalchen 23, wird am Koaserberg ermordet aufgefunden. An die Begebenheit erinnert ein „Marterl“ an einem Baum in der Neißinger Straße.
- 11.6.1902: Zu Ehrenbürgern für die Verdienste zur Förderung des Fremdenverkehrs werden ernannt:
- der Gutsbesitzer und Erbauer des Schlosses Litzlberg und ehemalige Begleiter des Kaisers Maximilian I. von Mexiko Baron Eduard Springer, Litzlberg 1,
- die Villenbesitzer Josef Fichtl, Franz Laingruber, Friedrich Müller und Ludwig Christ
- 4.8.1902: Kaiser Franz Joseph I. macht mit König Carol von Rumänien eine Rundfahrt mit dem Atterseedampfer.
- Im Jahre 1902 erfolgt der Ausbau des hinteren Teils des Hauses Nr. 46 (heute Hauptstraße 1) durch Errichtung von Armenwohnungen und Isolierlokalitäten.
- Im Jahre 1902 wird die Familiengruft der Familie Seyrl, Frl. Luise Seyrl und Rosina Seyrl, erbaut.
Die Pieta schafft der Bildhauer Wilhelm Seib. Sie wird 1905 aufgestellt.
1903
- Gemeindevorsteher 1903-1906: Mathias Lechner, Bauer in Kemating 5.
Als Armenvater wird Johann Krempler, Bauer in Steindorf 24, gewählt. - 16.-20.4.1903: Starker Schneefall, Schneetiefe im Gebirge: 1,20 m
Infolge des großen Schneefalls findet in Siebenmühlen eine Zugentgleisung statt. - 1.10.1903: Frl. Maria Holzinger wird mit Beschluss als Lehrerin für die Volksschule Seewalchen bestellt.
- 9.12.1903: Das Umlegen der Straße nach Neissing (am Holzberg) wird beschlossen.
Straßenerhaltungsbeitrag
(Originaltext von Max Laminger)
Anlässlich der Ausschusssitzung am 9.12.1903 wird von einem Ausschussmitglied der Antrag gestellt, da die Gemeinde durch Verbesserungen der Straßen sich große Kosten leistet, auch bedacht sein sollte, solche Unkosten durch das Einheben von Straßenerhaltungsbeiträgen zu vermeiden. Da ist zum Beispiel die Brauerei Attersee, die täglich mit zwei Fuhrwerken auf den Seewalchner Straßen Bier verführt, welche hiedurch ein großer Schädling der Straßen ist und daher zur Leistung eines Straßenerhaltungsbeitrages herangezogen werden muss.
Die Entgegnung des Bürgermeisters ist, da der gesamte Brauereibetrieb versteuert sei und Betriebsmittel im einzelnen jedoch nicht versteuert werden dürfen, könne auf die Brauerei kein Zwang zur Heranziehung von Straßenerhaltungsauslagen ausgeübt werden, aber sie könne um eine freiwillige Beitragsleistung ersucht werden. Der Ausschuss werde es halt mit der freiwilligen Beitragsleistung versuchen, weil ja auch freiwillig das Bier gesoffen werde.
Nach den Erhebungen zufolge scheint bei der Gemeinde keine Beitragsleistung der Brauerei auf.
________________________________________________________________________________________________________
1904
- Im Jahr 1904 wird ein neues Feuerwehrdepot (im Anschluss an das Wirtschaftsgebäude Stallinger) errichtet.
- 19.3.1904: In Wien stirbt der Ehrenbürger Friedrich Paulick.
- Große Kälte Anfang des Jahres, der See ist von Mitte Februar bis Anfang April zugefroren. Es gibt auch heftige Schneestürme.
- 6.8.1904: Der Schulleiter Adolf Gattringer wird für sein verdienstvolles Wirken an der hiesigen Volksschule zum Ehrenbürger ernannt.
- 29.8.1904: Infolge Brandlegung durch Sinnesverwirrung der Josefa Kletzl, Seewalchen 24, entsteht ein Zimmerbrand, wobei sie den Erstickungstod findet.
- 10.11.1904: Markus Kroiß wird als definitiver Schulleiter der Volksschule bestellt.
1905
- 1.3.1905: Beginn des Umbaues der Neißinger Straße.
- 1.4.1905: Im vormaligen Sommerpostamt wird der Ganzjahresbetrieb aufgenommen. Der Zustelldienst erfolgte aber weiterhin (bis nach dem 2. Weltkrieg) vom Postamt Kammer.
- 22.5.1905: Die Kirche erwirbt vom Stift Michaelbeuern das Mesnerhaus (Kirchenplatz).
- 3.9.1905: Dem Gemeindearzt Dr. Oskar Hauttmann, Kammer, wird mit Beschluss die Gemeindearztstelle gekündigt.
- 17.10.1905: Mit Beschluss wird der Gemeindesekretär Johann Aicher wegen freiwilliger Zurücktretung entlassen. An dessen Stelle tritt ab 1.11. Georg Kump, Seewalchen 27, mit monatlichen 50 Kronen Gehalt.
- Pfarrer P. Felix Kohler - seit dem Jahre 1894 in Seewalchen - wird im Jahre 1905 von P. Roman Baumgartner, Dr. der Theologie, abgelöst.
- Im November finden Demonstrationen für ein allgemeines Wahlrecht statt.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1905: Einnahmen: 12042,50 K Ausgaben: 13274,04 K Steuerleistung: 19712,33 K.
Die Jahre 1906 bis 1910
1906
- Für die Periode 1906-1909 wird als Gemeindevorsteher Mathias Gaubinger, Bauer in Reichersberg Nr. 3, gewählt.
Nach dessen Rücktritt im Juli 1906 wird Josef Gunst, Bauer in Seewalchen Nr. 18, und nach seinem Ausscheiden, das vom Gemeindeausschuss verlangt wurde, ist vom 15.2.1907 bis zum Ende der Periode 1909 Carl Häupl, Gastwirt in Seewalchen, Gemeindevorsteher. - 28.2.1906: Mit Beschluss wird dem Herrn Dr. Ludwig Kronberger in Schörfling die Gemeindearztstelle mit einem jährlichen Pauschalbetrag von 600 Kronen zuerkannt.
- 13.-15.4.1906: Großer Waldbrand in Weißenbach. An der Brandbekämpfung beteiligt sich auch die Frw. Feuerwehr Seewalchen.
- 24.5.1906: Der Gemeindediener Franz Idlhammer wird mit monatlich 20 Kronen pensioniert.
- 15.9.1906: Max Laminger wird als Gemeindesekretär an Stelle des abgetretenen Georg Kump bestellt. Als Gemeindediener wird Franz Lacher, Seewalchen 91, bestellt.
- Im Jahre 1906 beginnt Karl Weidinger sein Handwerk als Brunnenbauer.
1907
- 26.1.1907: Kaiser Franz Joseph I. sanktioniert das Gesetz über das Einführen des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechtes in Österreich.
- 1.4.1907: Seewalchen wird an den Fernsprechverkehr angeschlossen und beim Postamt (heute Kirchenplatz 3) wird eine Telefonsprechzelle errichtet.
- 13.6.1907: Das Haus Unterbuchberg 8 des Mathias Aigner, Attersee, brennt aus unbekannter Ursache bis auf die Grundmauern nieder.
Elektrischer Strom
- Im Jahre 1907 wird vom Transformatorhaus Schörfling die Starkstromleitung der Firma Stern & Hafferl errichtet. Gleichzeitig wird vom Verschönerungsverein Seewalchen mit einem Kostenaufwand von 1.000 K. für das Erbauen des Sekundärnetzes für die Straßenbeleuchtung mit 28 Lichtauslässen in der Ortschaft Seewalchen Vorsorge getroffen. Diese Anlage wird von der Firma Stern & Hafferl unentgeltlich mit einem Centralschalter ausgerüstet.
Wie bei jeder Neuerung konnte auch die Einführung des elektrischen Lichtes anfangs nur mit großer Gegnerschaft vorgenommen werden. - In der Pfarrchronik findet man die Eintragung: „Auf der Seewiese wurden Stangen der sekundären elektrischen Leitung aufgestellt. Wird eine Stange unbrauchbar und durch eine neue ausgewechselt, so gehört die alte dem Pfarrhof.“
- In der Schulchronik liest man:
„Über Ansuchen der Schulleitung hat sich die Gemeinde herbeigelassen am 14. Februar 1907 das elektrische Licht in die Wohnung des Schulleiters und der Frl. Holzinger einleiten zu lassen.
Fr. Maier, welche sich ausdrückte, sichs nicht zu verlangen, wurde deshalb auch nicht berücksichtigt.
Die Einleitung kostet in der Schulleiterwohnung ohne Beleuchtungskörper 65 Kronen, in der Lehrerwohnung 30 Kronen. Überdies wird für Beleuchtungskörper im Ganzen bewilligt: 20 Kronen.
Als am 14. Feber 1907 die Einleitungsarbeiten begonnen wurden, sah sich Frau Mayr leid u. unternahm weitere Schritte um dasselbe doch zu erhalten. Diese Frau ging nun zu den einzelnen Gemeindeausschußmitgliedern u. bat neuerdings um Bewilligung d. Einleitung in ihre Wohnung. Bei der Sitzung des Ortsschulrates am 3. März 1907 wurde das neuerliche Ansuchen genehmigt.
Die Beleuchtung wird von den Lehrern selbst bezahlt."
________________________________________________________________________________________________________
- 6.12.1907 Zu Ehrenbürgern werden ernannt:
- Carl Leiß, Kalkbrenner in Seewalchen, früherer Bürgermeister und Gründer des Vorschusskassenvereines (Raiffeisenkasse).
- Anton Stallinger (Kleinmüller) für Verdienste um das Armenwesens
- sowie die Villenbesitzer Karl Ramsauer, Wilhelm Deckert und Julius Wimmer,
1908
- 6.1.1908: Gründung der Frw. Feuerwehr Pettighofen. Zum ersten Kommandanten wird Bernhard Lacher gewählt.
- 17.8.1908: Mit Beschluss werden für die zu erbauende Wasserleitung der Ortschaft Seewalchen 2.000 Kronen bewilligt. Weiters werden für das Ankaufen einer Schreibmaschine 475 Kronen bewilligt.
- 14.10.1908: Da die alte Saugspritze der Feuerwehr schon stark abgenützt ist, wird Sattlermeister Franz See beauftragt, dieselbe sowie einige Bestandteile der neuen Saugspritze zu reparieren. Die Kosten der Reparatur von K 67.20 hat die löbliche Gemeindevertretung der Feuerwehr vergütet.
- 3.11.1908: Als Fleischbeschauer wird der Gemeindediener Franz Lacher bestellt.
- 1.12.1908: Am Vorabend des eigentlichen Kaiserjubeltages wird bei der Ulme am Gerlhamerwege ein Höhenfeuer abgebrannt.
- Der Ehrenbürger Wilhelm Deckert lässt auf eigene Kosten die Promenade verbreitern und mit Kastanienbäumen bepflanzen.
1909
- Gemeindevorsteher 1909-1912: Franz Hemetsberger, Neißing 6.
- 12.9.1909: Zugentgleisung in Kammer: Die Lokomotive, 3 Waggons und der letzte Personenwaggon stürzen um. Von 19 Fahrgästen werden 2 schwer und 8 leicht verletzt. Schlechter Unterbau war die Unfallursache.
- Im Jahre 1909 gründet Hermann Kastinger seinen Schuster-Betrieb.
1910
- 30.1.1910: Das Ankaufen einer Wertheimkasse wird beschlossen.
Wasserversorgung
Im Jahre 1908 wird einem langjährigen Bedürfnis der Ortschaft Seewalchen entsprechend beschlossen, an Stelle der bestehenden hölzernen Rohrwasserleitung mit fünf öffentlichen Wasserausläufen, und zwar bei den Häusern Nr. 1, Nr. 4, Nr. 29, Nr. 30 und Nr. 51, eine Hochquellenleitung mit Reservoir und eisernen Rohren zu errichten. Diesbezüglich wird von Fa. Rumpl, Wien, ein Projekt ausgearbeitet, werden die Statuten des Wasserversorgungsvereines verfasst und deren Bewilligung mit Erlass der oö. Statthalterei in Linz vom 23.12.1908 erlangt.
Am 22.11.1908 werden von dem neugewählten Verein gewählt:
Obmann Carl Häupl, Gastwirt; Stellvertreter Franz Stallinger, Kassier und Schriftführer Max Laminger.
Betreffend das Projekt zum Erbauen der Wasserleitung in Seewalchen ist das ganze Jahr 1909 den Vorarbeiten gewidmet und es kann nach mehrfachen kommissionellen Verhandlungen und Vereinbarungen mit den alten Wasserbezugsberechtigten, wobei auch die Enteignung des erforderlichen Grundes für das Hochreservoir und das Quellenschutzgebiet von Franz Mayrhofer in Seewalchen vorgenommen werden musste.
Im Februar 1910 wird das Errichten der Wasserversorgungsanlagebauten an die Fa. Österr. Wasserwerke-Baugesellschaft in Wien vergeben und am 16.3.1910 wird mit dem Bau begonnen.
Die Kosten der Wasserleitung samt allen Nebenleitungen und Hochreservoir mit Quellenfassung sowie Schächte zusammen 37.500 Kronen.
Am 12.6.1910 erfolgt die feierliche Eröffnung der neuen Kaiser-Jubiläums-Wasserleitung unter Beteiligung sämtlicher Korporationen und Vereine. Festzug, Ansprachen, Musik und Weihe der Anlage stehen am Programm. Ein Hoch auf den Kaiser bildet den Schluss des Festes, worauf die Musikkapelle die Volkshymne intoniert.
________________________________________________________________________________________________________
- 5.6.1910: Hermann Flöge, Villenbesitzer in Seewalchen 83, wird für seine Unterstützung zum Bau der Ortswasserleitung zum Ehrenbürger ernannt.
- 9.7.1910: Es wird beschlossen, dass der Wasserzins mit der Gemeindeumlage einzuheben ist.
- 14.8.1910: Die Pfahlbaudorf-Rekonstruktion in Kammerl wird eröffnet.
(1922 wird das Pfahlbaudorf für Filmaufnahmen niedergebrannt. Dieser Film („Sterbende Völker“) kam in die Sowjetunion und galt lange als verschollen. Im Jahr 2018 konnte eine Kopie in einem russischen Archiv gefunden werden und die ca. 20“ lange Szene des Brandes dem Heimathaus Schörfling zur Verfügung gestellt werden.)
Einige Zahlen
Volkszählung 1910: 1750 Einwohner (Steuergde. Seewalchen: 1147; Steuergde. Litzlberg: 603 Einwohner) 363 Häuser (Steuergemeinde Seewalchen: 120 Häuser; Litzlberg 243 Häuser) Rechnungsabschluss der Gemeinde 1910: Einnahmen: 14737,13 K Ausgaben: 14709,25 K Gemeindeumlage: 40 %, Steuerleistung: 20477,64 K. Bierumlage: 1 Krone pro Hl. lt. Beschluss vom 11.4. Jagdpächter Carl Leiß zahlt jährlich 393 Kronen Jagdpacht von 1910-1916.
Die Jahre 1911-1915
1911
- Im Juli und August 1911 wird der Kirchturm mit einem Kostenaufwand von 1.600 Kronen durch Maurermeister Karl Rachstorfer restauriert. Ebenso wird die Filialkirche Kemating hergerichtet, wobei bei der Erneuerung des Turmdaches die frühere Kuppel nicht mehr hergestellt wird.
- 23.8.1911: Verheerender Sturm, der in der Gemeinde durch Niederlegung ganzer Waldstriche, Entwurzelung der Obstbäume und Abtragung der Dächer großen Schaden anrichtet.
Mehrere Heustadel werden in der Brunellerwiese (westlich von Roitham) zur Gänze demoliert.
(Anmerkung: Das Datum dieses Sturms wird in anderen Aufzeichnungen mit 24.8.1911 angegeben. - Das Jahr 1911 ist trocken, aber fruchtbar.
- 29.10.1911: An diesem Tage findet die feierliche Installierung des Hwst. Herrn Pfarrer P. Severin Böhm statt. Er kommt an Stelle von Dr. Roman Baumgartner.
- 13.11.1911: Eröffnung der Volksschule Arnbruck.
86 Schüler der Volksschule Seewalchen (aus den nordöstlichen Teilen der Pfarre) werden nach Arnbruck überwiesen. - 16.11.1911, 22.33 Uhr: Erdbeben in der Dauer von 10 Sekunden, dem ein sonderbares Geräusch folgt.
1912
- Für die Periode 1912-1915 wird als Gemeindevorsteher Franz Stallinger, Sägemüller in Pettighofen, gewählt. Nachdem jedoch infolge des Weltkrieges 1914 sämtliche Wahlen eingestellt werden, muss er bis Mai 1919 als Gemeindevorsteher bleiben.
- 29.2.1912: Das Haus Kraims 8 brennt aus nicht bekannter Ursache bis auf die Mauern nieder.
- Im Jahre 1912 wird in Kraims die Brunnberg-Wasserleitung mit 160 m Länge gebaut. Im selben Jahr wird auch in Steindorf die untere Dorfwasserleitung mit 100 m Länge gebaut.
1913
- 14.1.1913: Eröffnung der Lokalbahn Vöcklamarkt-Attersee. Es wird dadurch auch eine bessere Verkehrsverbindung für die Bewohner des südlichen Gemeindeteiles geschaffen.
- 25.7.1913: Landung eines Kugelballons aus Deutschland in Staudach.
- Im Jahre 1913 erhält die Pfarrkirche Seewalchen nach erfolgter Innenrestaurierung durch Malermeister Helminger aus Attnang eine elektrische Beleuchtung.
1914
- 28.6.1914: Ermordung des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo.
Allgemeine Mobilisierung
Am 30.7.1914 um 17.00 Uhr langt ein Telegramm wegen „Allgemeiner Mobilisierung“ ein.
Über allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlich Königlichen Majestät wird die Alarmierung und „Allgemeine Mobilisierung“ angeordnet.
Um 21.00 Uhr schallt vor dem Gemeindeamt der schaurigschöne Alarmruf durch Trompeter Johann Mayr in die Umgebung hinaus. Die ersten Mobilisierungstage sind mit der Einrückung der einberufenen Mannschaft ausgefüllt, welche durchwegs mit Begeisterung und Hoffnung auf baldige Beendigung des Krieges einrücken, wobei die Hoffnung durch die 4-jährige Dauer des Krieges zur Schande wird.
Am 6.8.1914 wird die Straßensperre für Automobile und das Bilden eines eigenen Wachkommandos für das Bewachen bei Tag und Nacht beim Hause Nr. 30 in Seewalchen (heute Oberndorfer-Filiale, Hauptstraße 4). In der Folge wird auch das Bewachen des Wasserreservoirs und der Feuerwache angeordnet. Es hat jeder Hausbesitzer der Ortschaft Seewalchen die verfügbare Mannschaft beizustellen.
Am 15.8.1914 kommt der Auftrag wegen des Beistellens von 30 landesüblichen Wirtschaftswägen mit je zweispännigem Pferdezug und Fuhrmann. Bei diesem Trainfuhrwerk rückt auch Franz Achleitner, Spediteur in Seewalchen Nr. 102, freiwillig mit dem Fuhrwerk des Johann Sulzberger, Seewalchen 42, ein und wird in Galizien vermisst.
(Achleitner war der Gründer des Musikvereines Seewalchen)
Am 15.11.1914 erfolgt der Auftrag wegen Beistellen von Sommerwohnungen für evakuierte Flüchtlinge aus Galizien. Mangels Reinlichkeitssinn können sich diese Personen keiner Beliebtheit erfreuen.
________________________________________________________________________________________________________
- Die Kammer-Agerbrücke wird mit einem Kostenaufwand von 42.000 Kronen, wovon die Gemeinde Seewalchen einen Teilbetrag von 7.000 Kronen zu leisten hat, von der Fa. Wayß in Linz erbaut. Sie wird im Juli 1915 eröffnet.
Bis zu diesem Zeitpunkt bestand eine 3-jochige Holzbrücke.
(In den Jahren 1971 und 1972 wurde die neue Brücke über die Ager gebaut. Dabei war der Abbruch der alten Brücke aus 1914 notwendig, wobei die Sprengung am 17.2.1972 erfolgte.)
1915
- 15.2.1915: Gemeindesekretär Max Laminger wird zur militärischen Dienstleistung einberufen. Die Vertretung übernimmt der Gemeindediener Franz Lacher bis 27.7.1918.
- Im Jahre 1915 beginnt eine Fülle von Arbeit für die Gemeinde durch die Unmenge von Anforderungen in allen Bedarfsgegenständen. In periodischen Abständen wird das Aufbringen von Getreide, Heu, Stroh, Vieh, Metall und Wolle befohlen und es ist die Gemeinde für das restlose Aufbringen verantwortlich.
Eine der schwierigsten Aktionen ist neben den Kriegslieferungen die Versorgung der Zivilbevölkerung im Hinterlande. Besonders bei Mangel der notwendigen Vorräte gibt das Zuweisen der Bedarfsgegenstände wie Mehl, Brot, Fett, Fleisch, Tabak und Milch mittels Karten eine Fülle von Arbeit.
Die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die erst in der Nachkriegszeit durch die Aufhebung des Rationierungszwanges und die Bewilligung des freien Verkehrs mit Bedarfsartikeln sein Ende nimmt, ist sehr groß.
Einige Verfügungen aus dieser Zeit:- Getreide ist zu Nahrungszwecken zu verwenden.
- Weizen und Korn sind nur mehr zu 50 % zur Broterzeugung zu verwenden.
- Einführung der Brotkarten: 1 Person wöchentlich 1,40 kg Mehlprodukte. Vorräte über 20 Kilo werden eingezogen.
- Fleischverkauf ist nur an 5 Tagen der Woche gestattet.
- Haferfütterung: Für 1 Pferd ist pro Tag 1 Kilo erlaubt.
- Weizenbackmehl und Weizenkochmehl dürfen zur Broterzeugung nicht verwendet werden. **Erzeugung von Kleingebäck ist verboten.
- Durch die Lebensmittelrationierung dürfen wegen der besseren Überwachung nur mehr die „Bezirksmühlen“ Getreide ausmahlen.
Für Seewalchen (sowie Aurach, Oberachmann und Schörfling) ist die Stinglmühle (an der Ager) zuständig.
Rechnungsabschluss 1915: Einnahmen: 15467,76 K. Ausgaben: 15458,92 K. Gemeindeumlage: 35 %, Bierumlage: 1 Krone pro Hl., Steuerleistung: 22201,15 K.
Die Jahre 1916 bis 1920
1916
- 21.4.1916: Die Sommerzeit wird eingeführt.
- 21.5.1916: Erneuter Brand in der Papierfabrik Pettighofen.
- Auszug aus den Approvisionierungsvorschriften
(=Lebensmittelverteilung-Vorschriften) vom Jahre 1916:- Zucker darf nur gegen Karten verabreicht werden: (1 Person 1,25 kg in 4 Wochen. Schwerarbeiter: 1,40 kg).
- Schlachten weiblicher Ziegen ist verboten.
- Ablieferung von Metall und Zinn sowie Geräten aus diesen.
- Kartoffelkarten werden aufgelegt: pro Person ¼ kg in 8 Wochen.
- Gewerbliche Schlachtung von Schweinen unter 60 kg ist verboten.
- In den Gasthäusern wird die Verabreichung von Kartoffeln in Fett oder Butter verboten, Fisch oder Fleischspeise darf pro Person 11 dag, bei Braten 15 dag nicht überschreiten.
- Jedem Kunden darf nur 1 Liter Bier verabreicht werden. Ausschankzeit ist von 7-10 Uhr und von 16-22 Uhr.
- Der Verkehr mit Milch wird geregelt. Rahm und Oberserzeugung sind verboten.
- 21.11.1916: Seine Majestät Kaiser Franz Joseph stirbt.
- 28.11.1916: Brand in der Papierfabrik Pettighofen, der rechtzeitig, ohne größeren Schaden lokalisiert werden kann.
1917
- 10.4.1917: Beschluss, dass der Erlös für die von der Kirche abgelieferten Glocken, welcher für die Kriegsanleihe gewidmet wurde, als Eigentum der Gemeinde verbleibt.
- 19.8.1917: Einweihung der Kriegerdenkmalkapelle im Friedhof Seewalchen.
Die Kapelle war ursprünglich als Gruft für die Mitglieder der Familie Khevenhüller-Horváth bestimmt, wurde aber nicht als solche benützt.
Das Mosaikbild stammt aus Innsbruck. (Im Herbst 2000 wird die Kapelle abgerissen) - Die Kirche erhält ein neues Chorgestühl. Schnitzarbeit von Pfarrer Lininger aus Weyregg, Tischlerarbeit von Kette, Seewalchen; Marmor-Taufstein, Kommunionbank aus Marmor, Speisegitter vom Schlosser Lenzenweger, Seewalchen.
- Auszug aus den Approvisionierungsvorschriften vom Jahre 1917:
- Einkaufen von Most-Obst ist verboten.
- Kaffeebezugskarten werden eingeführt.
- Verbrauchsgetreide der Landwirte muss bis auf 80 % ausgemahlen werden.
- Mehlspeisen dürfen in Gasthäusern nur gegen das Einziehen der Brotkarten verabreicht werden.
- Petroleum darf nur gegen Bezugschein ausgegeben werden.
- Fleischverkauf ist nur am Montag und am Freitag.
- Kohlekarten und Kartoffelkarten werden eingeführt.
- Im Jahre 1917 kommt es in der Papierfabrik Pettighofen zu einem Großbrand.
1918
- 27.7.1918: Gemeindesekretär Max Laminger übernimmt seinen Dienstposten nach 3½ jähriger Kriegsdienstleistung im Kriegsgefangenenlager Grödig.
- Die Einstellung der Kriegshandlungen und Beendigung des Weltkrieges, die Auflösung und Heimkehr der Krieger sowie der Zerfall des alten Reiches und die Ausrufung der Republik am 12.11.1918 werden in der Gemeinde im allgemeinen ruhig aufgenommen. Man passt sich den Verhältnissen an.
- Die Toten des ersten Weltkrieges
Die Gemeinde stellte insgesamt 404 heimatberechtigte, kriegstaugliche Wehrmänner (Jahrgang 1865-1900), von denen 65 fielen oder vermisst sind.
Das Ende des Krieges
Eine ernste Beunruhigung entsteht infolge Plünderungen bei Durchmärschen im Gemeindegebiet bei der Rückkehr der Truppen vom italienischen Kriegsschauplatze. Mit Hilfe des deutschen Militärs in Salzburg kann der Abtransport der Soldaten mittels Eisenbahn bewältigt werden. Das Gemeindegebiet bleibt daher etwas verschont. Durch Zusammenwirken aller Verantwortlichen hinsichtlich der Verpflegung und der Aufbringung der hiezu erforderlichen Mittel können die anderwärts zum Ausdrucke gekommenen Störungen trotz der allgemeinen notwendigen Einschränkung vermieden werden. Die Ruhe ist mit Ausnahme einer Demonstration, die sich jedoch nur gegen den Fremdenverkehr richtet, bewahrt, was um so höher zu bewerten war, als durch den Mangel an Lebensmitteln bzw. von Lebensmitteln mit minderwertiger Qualität - insbesondere durch Streckung der Mahlvorräte durch Beigabe von Sägespänen, Knochenmehl und Kartoffeln und dergleichen- mit dem Fehlen des notwendigen Fettes und anderer Bedarfsgegenstände noch mehr wie während des Krieges ihr Auskommen finden müssen.
________________________________________________________________________________________________________
- An Stelle der abgelieferten Glocke wird am 8. September 1918 die von der Firma Böhler gespendete Glocke geweiht und aufgezogen.
- Im Jahre 1918 halten sich insgesamt 842 Fremde (Gäste) in der Gemeinde auf, dessen höchster Stand durch die Lebensmittelknappheit begründet ist.
- Auszug aus den Approvisionierungsvorschriften vom Jahre 1918:
- Landwirtschaftliche Arbeiter bekommen 225 g, Schwerarbeiter 300 g Getreide pro Tag.
- Konsumenten: Mehlbezug 250 g pro Woche und Brot 1150 pro Woche.
- Einführung der Tabakbezugskarten.
- Fleischgenuss in allen Betrieben am Montag, Mittwoch und Freitag verboten.
- Rosskastanien müssen abgeliefert werden.
Die Not nach dem Krieg
Die Zeit nach dem Krieg ist gekennzeichnet durch einen unglaublichen Lebensmittel-, Heizmaterial- und Rohstoffmangel. In entlegenen Bauernhäuser und Villen wird eingebrochen
Vom 14. Oktober bis Ende Dezember 1919 erfolgen 13 Villeneinbrüche im Seegebiet, darunter in den Ortschaften Buchberg, Litzlberg, Moos und Seewalchen.
Und die Wilderer versuchen die Hungersnot auf ihre Weise zu mildern.
Wo man Nahrungsmittel vermutet, sucht man auch.
Am 30.6.1919 findet in Seewalchen eine Arbeiterdemonstration statt, wobei die Gasthäuser Anton Stallinger und Franz Rosenauer das Ziel sind. Es werden Fenster demoliert und sonstiger Sachschaden angerichtet. Ursache ist die Lebensmittelknappheit.
Hamsterer ziehen herum, um zu Lebensmitteln zu kommen.
Die Sommerfrischler verlassen im Herbst 1918 nur ungern den Attergau, ist doch in den Städten die Situation noch schwieriger.
________________________________________________________________________________________________________
1919
- Nach dem neuen allgemeinen Wahlrecht für 5-jährige Dauer der Amtsperiode wird als Bürgermeister Karl Waliser, Bauer in Steindorf 33, gewählt.
- 9.3.1919: Mit Beschluss werden für den aufzustellenden Wirtschaftsrat für die Ernährung der Bevölkerung Herr Johann Mayr, Seewalchen 49, und Gustav Kristof, Pettighofen 13, gewählt.
- Gemeinderatswahlen 1919: Christlichsoziale: 188 Stimmen, Deutschfreiheitliche: 359, Sozialdemokraten: 247.
- 20.7.1919: Das Erbauen eines öffentlichen Landungssteges in Seewalchen wird beschlossen (Kinderbad).
- 27.8.1919: Das Haus des Franz Köstler (Ehrenobmann der Frw. Feuerwehr), Moos 10, brennt aus unbekannter Brandursache bis auf die Mauern nieder.
- 28.9.1919: Im Gasthaus Leimer, Pettighofen (gehörte damals zur Gemeinde Seewalchen) , wird der „Arbeiter-Musikverein Pettighofen-Lenzing“ gegründet.
- Zur Vervollständigung des Kirchengeläutes werden vom Böhlerwerk Kapfenberg zwei eiserne Glocken bestellt, welche mit der im Jahre 1918 von Herrn Böhler gespendeten Glocke als Ersatz für die abgelieferten Glocken das Geläute bilden.
Anschaffungspreis: 4.413,80 Kronen. - 2.10.1919: Es wird einstimmig beschlossen, den Verbindungsweg zwischen Villa Deckert (Rosenvilla) und dem Bootshafen von Wang (östl. des Strandbades) mit Rücksicht auf dessen mehr als 30 Jahre nachgewiesene Verwendung als unbedingt notwendiger Verbindungsweg zwischen Kammer und Litzlberg als öffentlich zu erklären.
- 6.11.1919: In Seewalchen wird ein Fernsprechvermittlungsamt (Postamt) eingerichtet.
- 16.12.1919: Franz Stallinger, Sägemüller in Pettighofen 14 wird für seine Verdienste als Bürgermeister im 1. Weltkrieg zum Ehrenbürger ernannt.
1920
- 17.2.1920: Es wird einstimmig beschlossen, die Mostausfuhr aus der Gemeinde mit Rücksicht auf den eigenen Bedarf infolge eingetretener Erhöhung der Bierpreise einzustellen. (Am 8.5.1920 wird der Beschluss wieder aufgehoben).
- 28.3.1920: Das Einführen der 7-jährigen Schulpflicht an der Volksschule wird beschlossen.
- 17.4.1920: Das Einführen einer gegenseitigen Versicherung im Brandfalle für Naturalleistung (Selbsthilfeverein) wird beschlossen.
- 1.5.1920: Adolf Bocksleitner wird Nachfolger seines Schwiegervaters Markus Kroiß als Schulleiter der Volksschule Seewalchen.
Der Lehrer Anton Schmoller wird an die hiesige Volksschule versetzt.
- Der Gemeindesekretär erhält eine 200%ige Teuerungszulage vom Grundgehalt per 300 Kr., das sind insgesamt 900 Kr. pro Monat.
Notgeld
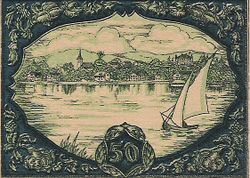
Die Bevölkerung leidet bitterste Not.
Es herrscht Mangel an Lebensmitteln und Kleidung, die Krone sinkt auf ein Zehntausendstel ihres Wertes, weshalb die Gemeinde - wie viele Gemeinden in Österreich - genötigt ist, Notgeld auszugeben.
Am 8 Mai 1920 erfogt der Beschluss des Gemeindeausschusses, der Wert des Seewalchner Notgeldes beträgt 100.000 Kronen.
Die Scheine bleiben aber nicht lange im Umlauf, die Inflation sorgt dafür, dass man so kleine Werte bald nicht mehr braucht.
Theater
25.7.1920: Die Dilettanten Theatergesellschaft führt auf der neuerbauten Bühne im Saale des Herrn Stallinger die Bauerntragödie „Der G'wissenswurm“ von Ludwig Anzengruber auf.
Die Dekorationen stammen vom akad. Maler Richard Teschner. Die Musik besorgt eine eigene Theaterkapelle.
Die Karten kosten von 4 bis 10 Kronen.
Insgesamt wird an 3 Tagen gespielt.
Am 25.11.1919 gründeten 21 Bürgerinnen und Bürger von Seewalchen die Dilettanten-Theater-Gesellschaft. Im Jahre 1920 wurde die Dilettanten-Theaterbühne im Salon des Gasthauses Stallinger erbaut.
Später spielte die Gruppe im „Haus des Fremdenverkehrs“ und zuletzt im Kultursaal und im Saal der Landesmusikschule.
________________________________________________________________________________________________________
- 28.8.1920: Dem Gemeindesekretär werden monatlich 2.000 Kronen, dem Gemeindediener 1.000 Kronen bewilligt.
- Ab Mitte August 1920 folgen 3 Wochen lang anhaltende Regengüsse. Der Attersee tritt aus den Ufern. In Kammer und Seewalchen sind die niedriggelegenen Häuser und Geländeteile bis 8. September überschwemmt. Im Schlosshof von Kammer kann man mit Schifferln herumrudern. Die Ager ist angeschwollen und die Traun reißt im Oberlauf alle Brücken hinweg und verwüstet die Ufer.
- Im Jahre 1920 eröffnet Rudolf Hemetsberger in Seewalchen 97 sein Friseurgeschäft.
Einige Zahlen
Laut Volkszählung 1920 sind in der Gemeinde Seewalchen 1819 Einwohner, in der Ortschaft Seewalchen 614 Einwohner. 1920 halten sich 624 Fremde (Gäste) in der Gemeinde auf. Rechnungsabschluss 1920: Einnahmen: 1,032 Mio. K., Ausgaben 1920: 1,027 Mio. K. (Wirtschaftsrat) Einnahmen: 588.710,48 K., Ausgaben 1920: 584.898,17 K. (Gemeinde) Gemeindeumlage: 60 %. Bierumlage: 1 Krone pro Hl. Fremdentaxe: Pro Person 10 Kronen bleibt aufrecht, vorübergehend in Gasthäusern pro Tag 1 Krone. Steuerertrag: 30.955,35 K.
| Chronik der Marktgemeinde Seewalchen |
|---|
1850 - Beginn der Aufzeichnungen - Übersicht 1851-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 |
Die Jahre 1921 bis 1925
1921
- 24.3.1921: Für die Schulleiterstelle Seewalchen wird Adolf Bocksleitner vorgeschlagen.
- 17.4.1921: Die Erbauung eines Landungssteges (heute Kinderbad) wird beschlossen.
- 24.5.1921: Wegen Radfahrverbot an der Seepromenade werden die Tafeln entsprechend ausgefertigt und als
Strafbetrag 20 - 200 Kronen als Vorschreibung beschlossen. - 13.8.1921: In der Sitzung des Gemeindeausschusses wird die Einführung der Sperrstunde ab 12 Uhr Mitternacht beschlossen.
Jede Person, welche in der Zeit von- 12-1h betreten wird, hat 100 Kronen,
- von 1-2h - " - " - hat 200 Kronen,
- von 2-3h - " - " - hat 300 Kronen,
- von 3-4h - " - " - hat 500 Kronen,
- von 4-6h - " - " - hat 1000 Kronen Strafe zu entrichten.
Jeder Gemeindeausschuss ist berechtigt, im Betretungsfalle die Anzeige zu erstatten.
- 24.10.1921: In der Papierfabrik Pettighofen explodiert ein Dampfkessel, wobei der Maschinführer Johann Köttl tödlich verunglückt.
Die Maschinengehilfen Josef Trawöger, Felix Kastberger und Franz Mayrhofer haben durch die Verbrühung schwere Brandwunden erlitten. Josef Trawöger erliegt diesen Verletzungen nach einigen Tagen. Ursache der Explosion war Dampfüberlastung.
1922
- Im Jänner 1922 wird P. Severin Böhm als Pfarrer abberufen.
(Er hatte mit seiner Wirtschafterin 2 Kinder, später heiratete er sie und wurde laisiert.)
Anmerkung: Nachfolger als Pfarrer wurde P. Gottfried Pflügl. - 26.6.1922: Der Blitz schlägt in das Haus Seewalchen 42 (Kapellenweg 7) im 1. Stock von der Dachrinne aus ein, geht durch den Plafond in die ebenerdige Wohnstube, ohne die beim Tisch sitzenden Personen zu verletzen.
- 16.12.1922: Betreff der weiteren Erhaltung der Straßenbeleuchtung wird einstimmig beschlossen, im Jahre 1923 nur 6 Ausläufe, und zwar: Brücke - Wang - Kapelle - Hemetsberger - Roither und Kletzl, halbnächtige Brenndauer, aufrecht zu halten.
1923
- Eine Lohnerhöhung für die Wegmacher pro Monat auf 250.000 Kr. für Starzinger und 200.000 Kr. für Schwarzenlander wird beschlossen.
- Mai 1923: Es kommt immer häufiger zu Zusammenstößen zwischen den Nationalsozialisten und den Sozialdemokraten. Auch auf dem Lande macht sich das Zunehmen des Nationalsozialismus bemerkbar.
- 11.8.1923: Über Ansuchen von Pfarramt und Schule wird einstimmig beschlossen, die öffentlichen Wege von der Villa Dr. Schuh (Atterseestr. 67) bis Raminger (heute Schulweg 16) und vorbeiführend an der Schule Seewalchen bis Gerlham für den allgemeinen Autoverkehr abzusperren. Übertretungen werden mit einer Geldstrafe bis 500.000 Kr. geahndet.
- Für die Straße Lenzinger Papierfabrik Pettighofen bis Pichlmühle in Siebenmühlen ist Verbot des Schnellfahrens für Auto und Radfahrer zu erlassen und durch Anbringung von geeigneten Tafeln ersichtlich zu machen. Dergleichen Verbot des Schnellfahrens am Wipplingerberg [Knäulberg, Reichersberger Straße] und um die Ecke beim Pfarrhof; diesbezügliche Verbotstafeln sind gleichfalls anzubringen.
- 2.10.1923: Rücktritt des Gemeindearztes Ludwig Kronberger infolge Ruhestand. Eine restliche Abfertigung von 1 Mio. Kr. wird bewilligt.
Dr. Fritz Seifert wird zum Gemeindearzt für die Gemeinde Seewalchen bestellt. - Für die Anschaffung einer Räderbahre werden 4 Mio. Kr. bewilligt.
- 24.10.1923: Brand im Haus Haidach 7.
Volkszählung 1923 Die Bevölkerung steigt in der Gemeinde seit 1900 von 1619 auf 1810 Personen an. Die Häuser haben sich in dieser Zeit von 363 auf 390 erhöht. Steuergemeinde Seewalchen: 589 männliche und 634 weibliche Personen, Steuergemeinde Litzlberg: 280 männliche und 307 weibliche Personen. Die Ortschaft Seewalchen hat 614 Einwohner (davon 282 männliche und 332 weibliche Personen)und 131 Häuser.
1924
- Für die Periode 1924-1929 wird als Bürgermeister Mathias Krempler, Bauer in Steindorf 30, gewählt. Zum Vizebürgermeister wird Johann Mayr, Koaser in Seewalchen 49 und zu Gemeinderäten werden Anton Lechner, Bauer in Kemating, und Hermann Kastinger, Schuhmacher in Seewalchen 127, gewählt.
- 24.1.1924: Gründung des gegenseitigen Pferdeversicherungs-Vereines.
- 1.3.1924: Die Attersee-Dampfschiffunternehmung Stern & Hafferl hat auch die Schiffe vom Rudolf Randa, Kammer, erworben.
- 1.4.1924: Die Schillingwährung wird eingeführt.
10.000 Kronen sind 1 Schilling (wirksam ab 1.1.1925).
Zuerst werden die 10.000 Kronen Scheine mit der Aufschrift „Ein Schilling” versehen, die ersten Schilling-Münzen werden am 16. Juni 1924 geprägt. - 6.4.1924: Ankauf eines Feuerwehr-Mannschaftswagens um 3,500.000 K.
- 2.6.1924: Der Bezirkswart für das Feuerwehrwesen, Dr. Rudolf Schuh, teilt in einem Schreiben an den Bürgermeister das Ergebnis einer Großübung in Steindorf mit. Die Feuerwehr, so wird in diesem Bericht aufgezeigt, braucht von der Brandmeldung bis zum Einsatz auf dem Brandplatz 48 Minuten.
Dr. Schuh weist in seinem Bericht besonders auf die Wichtigkeit der Errichtung von Löschwasserbehältern und auf die Anschaffung einer Feuerspritze hin. Gerade in Steindorf, wo die Häuser ziemlich eng aneinander gebaut sind, sei die Ausbreitung eines Brandes leicht möglich, meint Dr. Schuh. - 14.6.1924: Im Hause des Johann Neuhofer, Steindorf 4, entsteht ein Brand, welcher einen Teil des Daches beschädigt. Die Frw. Feuerwehr Seewalchen kann den Brand rechtzeitig lokalisieren.
- 22.7.1924: Durch Blitzschlag brennt das Anwesen des Franz Oberndorfer in Ulrichsberg ab.
- 25.10.1924: Der Frw. Feuerwehr Seewalchen werden mit Beschluss des Gemeindeausschusses zum Anschaffen einer Motorspritze 35 Mio. Kr. bewilligt.
- Gemeindeausschusswahlen 1924: Christlichsoziale, vereinigt mit den Deutschfreiheitlichen 652 Stimmen, Sozialdemokraten: 230 Stimmen.
- Im Jahre 1924 beginnt die Familie Kolm, Seewalchen 18, mit ihrem Molkereibetrieb (der Betrieb wird 1966 geschlossen).
- 1924 errichten Johann Lenzenweger und Hans Hofmann die erste Autoreparaturwerkstätte .
Die Bevölkerung hatte damals wenig Hoffnung in die Zukunft der Kraftfahrzeuge, damals „Eahmselm-Fahrer“ genannt und meinte: „Zwegen dem narrischen Doktor Hauttmann macht´s es a Werkstatt auf.“
Dr. Oskar Hauttmann aus Kammer hatte das erste Auto in der Gegend.
1925
- 25.3.1925: Das Anwesen des Johann Lux, Haidach 7, brennt bis auf die Grundmauern nieder. Die Brandursache ist nicht bekannt. Die Feuerwehr Seewalchen setzt erstmals die neue Motorspritze ein.
- 4.4.1925: Den Eheleuten Franz und Maria Köstler werden anlässlich der Goldenen Hochzeitsfeier S 100,-- gewidmet.
- 29.7.1925: In der Sitzung des Gemeindeausschusses wird beschlossen:
- dem Wasenmeister Josef Kroihs (Schörfling) den jährlichen Pauschalbeitrag von S 80,-- gleich seinem Vorgänger zu bewilligen;
- dem Ansuchen des Mesners Josef Köstler wegen Leistung seiner Entschädigung für das 11 Uhr Läuten dahin Folge zu geben, dass für das Jahr 1925 demselben seitens der Gemeinde-Vorstehung 4 m³ hartes Brennholz im Herbste 1925 zuzuweisen sind.
- 30.12.1925: An Hundesteuer für das 1926 wird beschlossen, für jeden Hund männlichen Geschlechtes 50 gr, weiblichen Geschlechts 1 Schilling einzuführen.
Einige Zahlen
1925 sind insgesamt 749 Fremde (Gäste) in der Gemeinde. Rechnungsabschluss der Gemeinde 1925: Einnahmen: S 70.467,74 Ausgaben: S 68.383,05. Steuerleistung: S 16.646,96 Gemeindeumlage: 20 % Lohnabgabe: 4 %; Wohnabgabe: 30 %.
Die Jahre 1926-1930
1926
Der große Brand von Steindorf
Am 8.4.1926 zwischen 24.00 und 1.00 Uhr nachts entstand aus ungeklärter Ursache beim Haus Steindorf 39 ein Brand, welcher sich wegen des herrschenden Windes über das ganze untere Dorf Steindorf ausbreitete, wobei 21 Objekte dem verheerenden Elemente zum Opfer fielen. Außer den gesamten Fahrnissen (= bewegeliche Güter) verbrannten noch 12 Stück Rinder und Pferde, 20 Schweine nebst zahlreichem Geflügel und in der weiteren Folge mussten noch 5 Rinder und 5 Schweine notgeschlachtet werden.
Entsprechend des Schadens war auch die Hilfe des ganzen Landes groß, sodass laut der in der Zeit vom 6.4.1926 bis 24.2.1927 abgeschlossenen Listen Spenden in bar S 133.403,85 eingegangen sind. Aus den umliegenden Gemeinden langten Naturalien in großen Mengen ein, ebenso Kleidungsstücke, Schuhe und sonstige Gegenstände.
Die Landesregierung stellte sofort eine Pionierabteilung für die Aufräumungsarbeiten zur Verfügung und 4 Lastautos für die Zufuhr des Baumaterials, sodass in verhältnismäßig kurzer Zeit sämtliche Objekte unter Dach gebracht werden konnten.
Eine ausgiebige Hilfe leistete auch der Selbsthilfe-Verein durch Lieferung von Holz und Robot. An den Holzlieferungen zum Aufbauen der Häuser beteiligten sich in ausgiebiger Weise die benachbarten Gemeinden, von denen einige das Holz für einen ganzen Dachstuhl beisteuerten.
Die Brandstätte wurde am 8.4. von LhStv. Dr. Schlegl, Landesamtsdirektor Attems und Bezirkshauptmann Dr. Lippe besichtigt.
________________________________________________________________________________________________________
1927
- 28.2.1927: Beim Watzinger-Häusl in Kraims 14 des Johann Moser bricht ein Brand aus, dem das ganze Objekt zum Opfer fällt. Die Brandursache war ein schlechter Rauchfang.
- 5.3.1927: Für die Schlauchbeschaffung zur Steindorferspritze werden S 200,-- bewilligt.
- 9.3.1927: Im Gasthaus Leingartner in Vöcklabruck wird der Fremdenverkehrsverband für den Attersee und Mondsee gegründet. Neben 18 anderen Gemeinden tritt auch die Gemeinde Seewalchen als Mitglied bei.
- 7.6.1927: Das alte Spritzenhaus wird an Herrn Georg Stallinger in Seewalchen um den Preis von S 1.000,-- verkauft und der Betrag wird der Frw. Feuerwehr Seewalchen zum Stärken des Baufonds überlassen.
- Im Juni 1927 werden die Ortschaften Buchberg, Haining, Ainwalchen, Neißing, Gerlham, Litzlberg und Moos vom starken Hagelschlag betroffen, der die gesamte Ernte vernichtet. Durch eine Landessammlung gelangen S 3.100,-- zum Aufteilen an die Betroffenen.
- 17.7.1927: Die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses auf der Stieglerwiese (heute Parkplatz vor dem Rathaus) findet statt, das um den Preis von S 5.800,-- erbaut wurde. Dank der Opferwilligkeit der Bewohner durch Leistung von Zug- und Handrobot und sonstigen Spenden wurde der Zeughausbau ermöglicht.
Bauführer waren Dr. Rudolf Schuh, Dr. Fritz Seifert, Johann Mayr und Max Laminger. - 27.8.1927: Das Ansuchen des Rudolf Waldmann wegen Anerkennung des Lokalbedarfes für das Autotaxigewerbe mit dem Standort Seewalchen 61 (heute Raiffeisengebäude) wird bewilligt.
- 28.8.1927: Das Bauen des Landungssteges Litzlberg wird beschlossen. Der dazu notwendige Seezugang wird von der Bräuin bewilligt.
- Für die Errichtung eines öffentlichen Tennisplatzes wird ein Teil der Stieglerwiese mit einer jährlichen Pacht von S 50,-- vergeben. (Heute ist dort der Kultursaal).
Heimatbuch
Direktor Adolf Bocksleitner ist der Verfasser des Buches „Seewalchen am Attersee“, ein Heimatbuch, das er dem Ehrenbürger Julius Wimmer widmete und dessen Gesamterlös für die Kirche in Seewalchen zur Anschaffung von Paramenten bestimmt war. Der Druck erfolgte im Jahre 1929 durch den Verlag Julius Wimmer, Linz.
Das Buch enthält neben allgemeinen Daten
- Geschichtliches über den Ort, die Kirchen, die Schule und den Amthof,
- eine Chronik der letzten 100 Jahre,
- eine Sammlung des heimatlichen Brauchtums,
- Sagen aus Seewalchen und Umgebung,
- Lieder und Gesänge u.a.
________________________________________________________________________________________________________
1928
- 28.1.1928: In der Sitzung des Gemeindeausschusses wird zum Antrag der Bau- und Betriebsunternehmung Stern & Hafferl wegen Konzession zum periodischen Betriebe von Personentransport mit Kraftwagen von Kammer-Attersee-Unterach und zurück beschlossen, keinen Einwand zu erheben, da die Straßen in dem dermaligen Zustande geeignet sind.
- 22.3.1928: Über Antrag des Bezirkshauptmannes Dr. Lippe wird wegen Ankaufen des erforderlichen Seegrundes [bei Menschick, Atterseestraße 88] zum Errichten eines Strandbades eine Ausschusssitzung einberufen und abgehalten, wobei mit 13:3 Stimmen das Ankaufen des Grundes abgelehnt wird.
- Winter 1927/28: Schneefreier Winter mit wechselnder Temperatur, sodass die Holzbringung von den Bergen ungemein schwierig ist. Durch den im Frühjahr auftretenden Frost treten große Fruchtbeschädigungen auf.
- 5.5.1928: Ansuchen des Verschönerungsvereines Seewalchen um verschiedene Herstellungen. Hierüber beschließt der Gemeindeausschuss einstimmig:
- 1) Die Anbringung einer elektrischen Lampe am Kirchenplatze nicht zu bewilligen.
- 2) Anlage eines Bürgersteiges: Von der Anlage ist abzusehen, jedoch wird die Gemeindeverwaltung beauftragt, einen Kostenvoranschlag wegen Instandsetzung des reparaturbedürftigen Straßengrabens von Häupl bis Seewirt bei der o.ö. Landesregierung einzubringen.
- 3) Zur Überwachung des Radfahrverbotes wird der Gemeindediener bestellt und das Radfahrverbot an den Fußsteigen in der Ortschaft durch Anbringung von Verbotstafeln beim Ein- und Ausgang des Friedhofes, bei Idlhammer, Holzinger, Aigner und Lechner verlautbart.
- 4) Den Gastwirten in Seewalchen ist aufzutragen, in den Vorhäusern eine Verbotstafel anzubringen, dass die Verunreinigung der Straßen strengstens verboten ist.
- Bachregulierung in Kemating
Die Besitzer in den Ortschaften Kemating und Staudach sowie einige Besitzer aus Steindorf nehmen das Regulieren des Kematinger-Kraimserbaches unter der Leitung des Ing. Weidhofer und mit den erhaltenen Landes- und Bundessubvention vor. Die Arbeiten werden zur allgemeinen Zufriedenheit im Juni 1928 beendet. Insgesamt werden 45 Joch (=23,84 ha) der Entwässerung mit einem Gesamtaufwand von S 68.093,80 zugeführt. Im Anschluss an diese Arbeiten bzw. Fortsetzung derselben hat sich eine neue Wassergenossenschaft Steindorf-Kraims-Ulrichsberg-Arnbruck zum Regulieren des Baches bis zur Ager gebildet. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht ausgeführt. - 2.6.1928: Um 9.30 Uhr brennt die zum Haus 105 gehörige Holzhütte des Mathias Raminger in Seewalchen samt Futtervorräten bis auf den Grund nieder. Das Feuer wurde durch ein dreijähriges Kind gelegt.
- 3.6.1928: Der Gemeindeausschuss bewilligt für das Erbauen eines Feuerwehr-Spritzenhauses in Steindorf S 1.200,--.
- 9.6.1928: Zwischen der Villa „Scheibenhof“ und Leiß in Moos erfolgt ein Zusammenstoß eines Lastautos der Fa. Stern & Hafferl mit dem vollbesetzen Lohnauto des Herrn Badinger aus Attersee, wobei Frau Hotelier Hofinger vom Münchnerhof in Salzburg und Frau Hotelier Irresberger aus Attersee sowie der Streckenwärter der Firma Stern & Hafferl schwer verletzt werden.
- 12.7.1928: Um 16.30 Uhr geht ein Hagelschlag nieder, welcher alle Ortschaften der Gemeinde verhagelt. Am meisten betroffen sind die Ortschaften Seewalchen, Roitham, Neißing, Ainwalchen, Kemating und Steindorf (Schäden von 30 bis 100%).
- 10.9.1928: Der Amthof Seewalchen geht infolge Zwangsversteigerung um den Preis von S 127.259,-- in das Eigentum des Erich Soupper über.
- 6.11.1928: Fahnenweihe des Kriegervereines 1914-1918 in der Pfarrkirche Seewalchen.
- 9.12.1928: Verkauf der Brauerei Litzlberg samt Grundbesitz an Frau Else Eichmann.
- Im Jahre 1928 wird auf dem Grundstück des Nikolaus Wang das Café Liehmann errichtet.
- Im Jahre 1928 wird die Eisenbahnbrücke über die Ager erneuert.
- Im Jahre 1928 eröffnet Johann Ploner sein Bauunternehmen.
1929
Zugefrorener See
Vom 7.-8.2.1929 war der See über Nacht von der Brendler-Villa [jetzt: Hotel Attersee] bis Lechner (Fischer in Moos) zugefroren. Erst am 21.2. fror der See zur Gänze und blieb bis zum 21.3. zu.
Obwohl der Attersee in der sorglosesten Weise mit Fahrrädern und Motorrädern befahren wurde und mehrere Eiseinbrüche zu verzeichnen waren, ertrank niemand.
Es war der kälteste Winter seit 154 Jahren. Laut österreichischer Wetterstatistik hatte es von Anfang Jänner bis Ende Februar nicht einen einzigen Tag Plusgrade.
Am 27.3.1929 konnte das Dampfschiff wieder die erste Fahrt nach Unterach machen. (Die Schifffahrt war in dieser Zeit von besonderer Bedeutung, weil es sonst keine Verkehrsmittel wie Auto oder Autobus gab.)
Siehe auch: Attersee (Eis)
________________________________________________________________________________________________________
- Im März tritt eine Grippe derart stark auf, dass in vielen Häusern fast niemand zum Betreuen des Viehs vorhanden ist.
- Landtags- und Gemeindeausschusswahlen 1929: Christlichsoziale und Deutschfreiheitliche: 677 Stimmen, Sozialdemokraten: 300 Stimmen
- 2.5.1929: Das Luftschiff „Graf Zeppelin“ fliegt von Wien kommend längs des Attersees nach Salzburg weiter. Die Länge des Luftschiffes beträgt 230 m.
- 5.5.1929: Bei der stattfindenden Konstituierung des Gemeindeausschusses für die Periode 1929-1934 werden gewählt:
Bürgermeister: Johann Mayr, Koaser in Seewalchen 49,
Bgm.Stv.: Johann Dachs, Bauer in Ainwalchen 8,
1. Gemeinderat (wäre heute Mitglied des Gemeindevorstandes): Anton Mayr, Bauer in Litzlberg 5,
2. Gemeinderat: Hermann Kastinger, Schuhmacher in Seewalchen 127. - 9.6.1929: Das Wiedersehensfest des Vereines „Kriegskameraden 1914-18“ findet verbunden mit einer Fahnenweihe unter Beteiligung fremder Krieger und Veteranenvereine mit 3 Musikkapellen und 16 Fahnen statt.
- 4.7.1929: Über Oberösterreich geht ein Westorkan, der im Lande großen Schaden anrichtet. Auch in der Gemeinde Seewalchen entsteht an Wäldern und Gebäuden sowie Obstgärten ein großer Schaden. Unter anderem reißt der Orkan das Dach von den Häusern Staudach 10, Buchberg 6 und Steindorf 21 und den Stadel des Hauses Steindorf 2 um.
An Gesamtschaden wird festgestellt: 18.760 Dachziegel, 1.780 m² Dachbeschädigung, 713 Obstbäume, 33.500 kg Klee, 6.900 kg Heu, 1.508 Festmeter Windbruch und 60 Joch Jungwald.
Ein Opfer des Sturmes ist auch Juliana Gebetsroither, geb. 1907, Tochter des Wagnermeisters Matthäus Gebetsroither, Litzlberg 7. Sie wird bei einer Bootsfahrt vom Sturm überrascht und ertrinkt beim Landungssteg Litzlberg. - Der Herbst ist ausnahmsweise trocken und warm, sodass am 6. Oktober noch eine Hitze von 25° herrscht und im See das Baden bei 17° möglich ist. Kurz darauf erfolgt ein plötzlicher Temperaturabfall.
Einige Zahlen
Nach der Zählung entfallen von der Fläche der Ortsgemeinde Seewalchen
2506 ha 07 a 71 m² = 4355 Joch: Steuergemeinde Seewalchen: 1180,3801 ha = 2052 Joch Steuergemeinde Litzlberg: 1325,7970 ha = 2303 Joch. Davon sind: Äcker: 912,6799 ha Wiesen: 759,4086 ha Weide: 18,4149 ha Gärten: 86,8951 ha Wälder: 292,9112 ha unproduktive Flächen: 1,7264 ha Straßen und Wege: 32,1850 ha Eisenbahn: 2,7335 ha Bauarea: 20,1412 ha Agerfluss: 8,6020 ha Attersee (im Gemeindegebiet): 369,7628 ha
1930
- Im Jänner 1930 wird in der Brauerei Litzlberg das letzte Bier gebraut.
- Ab Jänner 1930 führt die Familie Hinterholzer eine Gemischtwarenhandlung (Geschäft Hauptstraße 8, bis 1970).
- 14.2.1930: In Seewalchen wird eine postöffentliche Sprechstelle (Telefon) eingerichtet.
- 1.3.1930: Der Gemeinderat beschließt, der Frw. Feuerwehr Kemating zum Erbauen eines neuen Feuerwehrdepots einen einmaligen Betrag von S 2.000,-- zu bewilligen.
- 27.6.-3.7.1930: Heuschreckenschwärme verheeren große Teile von Österreich, teilweise ist sogar der Eisenbahnverkehr gestört. In der Gemeinde sind jedoch nur geringe Schäden festzustellen.
- 6.7.1930: Nach tropischer Hitze und regenloser Zeit im Juni kommt ein Hagelwetter mit Sturm und Wolkenbruch und es werden hiebei die Ortschaften Seewalchen, Pettighofen, Haidach, Roitham, Neubrunn, Kraims und Reichersberg sowie der untere Teil von Steindorf bis 70% verhagelt.
- 24.7.1930: Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr kommt plötzlich der Abfluss der Ager zum Stillstand, sodass das Wasser des Sees bis 5 m vom Ufer entfernt zurücktritt und ein bei der Kammerbrücke fahrendes Trauner trockengelegt wird.
Einer Wäscherin in Kammer verschwindet das Wasser beim Waschen.
Der gleiche Vorgang wurde auch vor Jahren von älteren Leuten beobachtet. (Wissenschaftlich wird dieser Vorgang „Seiches“ genannt.) - Der Stand der unterstützten Arbeitslosen Ende 1930 beträgt 80 Mann. Durch die Einstellung des Brauereibetriebes Litzlberg und der teilweisen Betriebseinstellung in der Papierfabrik Pettighofen entsteht im Jahre 1930 bei den Abgabeertragsanteilen und der Lohnabgabe eine Mindereinnahme von S 12.500,--, welche durch das Erhöhen der Gemeindeumlage hereingebracht werden muss.
Die wirtschaftliche Krise, besonders die Arbeiterentlassungen in den Fabriken Lenzing und Pettighofen haben zur Folge, dass schon in den Sommermonaten ein großer Andrang zum Anmelden der Arbeitslosenunterstützung ist, sodass der Stand im Monat August bereits 40 Personen beträgt. - Herbst 1930: Die Landwirte der Gemeinde erhalten eine Anbauprämie von S 20,-- pro Joch Grund, zusammen ergibt es einen Betrag von S 23.255,--.
- Im Jahre 1930 erwirbt das Ehepaar Hofmann den Litzlberger Keller und führt ihn als Gaststätte.
Einige Zahlen
1930 sind insgesamt 1293 Personen (Gäste) in Seewalchen. Rechnungsabschluss der Gemeinde 1930: Einnahmen: S 129.563,71 Ausgaben: S 127.746,65 Steuerleistung: S 18.882,79 Gemeindeumlage: 20 % Lohnabgabe: 4 % Wohnabgabe: 20 %
Die Jahre 1931-1935
1931
- Im März 1931 übernimmt Ignaz Rosenauer die Fleischhauerei (Hauptstraße 17).
(1962 wird die Liegenschaft an die Gemeinde verkauft.) - Im Juni 1931 wird der Kirchturm der Pfarrkirche Seewalchen von der Turmspitze abwärts bis zum Glockenturm mit 1500 kg Kupferblech neu eingedeckt. Die Kosten werden seitens des damaligen Pfarrers P. Gottfried Pflügl durch den Erlös für ein verkauftes Grundstück von S 9.600,-- aufgebracht.
- Durch den Ausfall der Niederschläge seit Februar werden die Wasserzuflüsse der bestehenden Wasserleitung in Seewalchen so schlecht, dass nur durch 3x tägliches Absperren die Deckung des Bedarfes aufrecht erhalten werden kann. Erst Anfang Juli normalisiert sich der Wasserzufluss.
- 5.7.1931: Um 10 Uhr stürzt die 18-jährige Hausgehilfin Maria Damm aus Gumpoldskirchen in den Attersee und wird ertrunken aufgefunden.
- Nach achtwöchiger Regenzeit tritt Kälte bis 0° ein, sodass bereits am 23.9.1931 der Schnee bis zum Höflberg herunter liegt. Im Oktober ist sodann durchwegs schönes Wetter.
- 4.10.1931: Der Bäckergeselle Robert Hackl, geb. 1914, aus Seewalchen bei Hüttmayr stürzt von der Adlerspitze im Höllengebirge ab.
- 10.10.1931: Auf Grund des Budgetsanierungsgesetzes 1930 wird einstimmig beschlossen, rückwirkend mit 1. Oktober die Bezüge der Gemeindeangestellten, und zwar die des Gemeindesekretärs Max Laminger um 6 % und die des Gemeindedieners Franz Lacher um 4 %, zu verkürzen.
- Gemeinderatswahlen 1931: Christlichsoziale: 331 Stimmen, Nationaler Block: 231; Sozialdemokraten: 279, Nationalsozialisten: 24.
- 18.11.1931: Um 0.30h verunglückt tödlich der am 17.12.1891 geborene Taxiunternehmer Karl Wehovar, Seewalchen 66.
Wehovar, der mit dem Taxiunternehmer Rudolf Waldmann vom Gasthaus Häupl nach Kammer fuhr, kam am Goldberg [heute Konditorei Rohringer] auf der schlüpfrigen Straße mit dem Auto ins Rutschen, kippte um, kam unter das Auto zu liegen und erstickte. Waldmann hingegen kam mit geringen Verletzungen davon. - Infolge der durch die Papierfabrik Pettighofen erfolgten Betriebseinschränkung werden 108 Arbeiter entlassen.
1932
- 1.6.1932: Josef Kirchgatterer wird zum prov. Gemeindediener bestellt.
- 16.7.1932: Dr. med. Rudolf Schuh, Zahnarzt in Seewalchen 99, wird für seine Verdienste um die Frw. Feuerwehr zum Ehrenbürger der Gemeinde Seewalchen ernannt.
- Im Sommer 1932 ist 4 Monate hindurch fast kein Regen, sodass im Herbst im Orte und in der Umgebung großer Wassermangel herrscht.
- Im Jahre 1932 ist der Höchststand der gewerblichen Arbeitslosen (125 Arbeiter) durch teilweise Betriebseinstellung der Lenzinger Papierfabrik.
In den Wintermonaten erreicht die Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt. Junge Menschen finden keine Arbeit, Schulentlassene keinen Lehrplatz, Familienväter keine Beschäftigung. Täglich klopfen viele Bettler an die Türen der Häuser.
1933
- 27.5.1933: Die deutsche Reichsregierung verhängt über Österreich die „Tausendmarksperre“. Deutsche Staatsbürger müssen vor einer Reise nach Österreich eine Gebühr von 1.000,-- Mark zahlen. Die „Tausendmarksperre“ ist eine große Schädigung des Fremdenverkehrs.
- 4.7.1933: Feierliche Primiz des hw. Herrn Johann Gebetsberger von Haining (1909-1974).
- Das Frühjahr und der Sommer bis Mitte Juli sind sehr verregnet, sodass die Getreideernte fast 3 Wochen später als in normalen Jahren ist. Es ist trotzdem eine gute Ernte, aber die Obsternte ausgenommen.
- 7.10.1933: Bürgermeister Mayr wird für seine Verdienste als langjähriger Kapellmeister und Bürgermeister zum Ehrenbürger ernannt.
1934
- Beginn einer neuen Nationalsozialisten-Terrorwelle mit Sprengstoffanschlägen.
Bürgerkrieg
Infolge des beabsichtigten sozialdemokratischen Putschversuches wird am 12.2.1934 das Standrecht für Oberösterreich verfügt. In Seewalchen selbst ist Ruhe, aber in der Papierfabrik Lenzing kommt es zu Ausschreitungen. Der Republikanische Schutzbund reißt im Bahnhof Lenzing die Bahngleise auf und besetzt die Fabrik.
Am 14.2.1934 wird die Besetzung der Fabrik durch Einsatz des Militärs und des Heimatschutzbundes aufgehoben und werden die Rädelsführer, insgesamt 13 Sozialisten, verhaftet.
In Seewalchen ist die Putschbeteiligung ganz gering.
Attnang und Holzleithen sind von den Unruhen besonders heimgesucht. In Holzleithen werden am 12. Februar 6 Männer, davon 3 Sanitäter erschossen.
Aufgrund der Auflösung der Sozialdemokratischen Partei werden in Seewalchen die Gemeindeausschussmitglieder Hermann Kastinger, Michael Lehner, Franz Feitzhofer, Franz Lang und Josef Lenzeder ausgeschieden.
________________________________________________________________________________________________________
22.3.1934: Eine Volkszählung wird durchgeführt, welche einen Bevölkerungszuwachs seit 1923 um 199 Personen ergibt: Steuergemeinde Seewalchen: 1455 Personen Steuergemeinde Litzlberg: 554 Personen Insgesamt: 2009 Personen Die Pfarrgemeinde Seewalchen mit den zugehörigen Ortschaften der Gemeinde Timelkam und zwar Arnbruck (466 Bewohner), Ulrichsberg (41 Bewohner), Thal (28 Bewohner) und der Gemeinde Berg, und zwar Brandham (64 Bewohner), Baum (27 Bewohner) und Rubensdorf (28 Bewohner) hat mit den Gemeindebewohnern von Seewalchen 2663 Personen.
- 25.7.1934: In Wien findet ein nationalsozialistischer Putschversuch statt, wobei Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß ermordet wird; in Seewalchen ist jedoch vollkommene Ruhe.
- 6.8.1934: Um 8.30 Uhr brennt das Haus der Ehegatten Moser, Staudach 3, bis auf die Grundmauern nieder.
Brandursache: Angeblicher Rauchfangschaden. - 15.8.1934: Der Pfarrer P. Gottfried Pflügl wird in das Stift Michaelbeuern versetzt und an dessen Stelle kommt P. Dr. Heinrich Scharl als Pfarrprovisor.
- 20.9.1934: Fritz Zimmel (Schulweg 3) übernimmt den Tapeziererbetrieb seines Schwiegervaters Franz See. (1966 wird der Betrieb geschlossen.)
- Ab Herbst 1934 heißt es nicht mehr Gemeindeauschuss sondern „Gemeindetag“.
- Das Jahr 1934 ist ein ausgesprochen trockenes Jahr, jedoch mit einer sehr guten Ernte, insbesondere die Obsternte.
- 18.10.1934: Erster Schneefall, dann jedoch schneefrei bis 6.1.1935.
- 22.10.1934: Die Gemeindevertretung wird aufgelöst und als Regierungskommissär wird der Schmiedemeister Josef Frickh, Seewalchen, bestellt.
- 30.10.1934: Josef Frickh wird aus Gesundheitsgründen als Regierungskommissär enthoben und der Landwirt Johann Dachs, Leitner in Ainwalchen, wird für dieses Amt bestellt.
- 6.12.1934: Die Lehrerin Frl. Maria Holzinger wird für ihr verdienstvolles Wirken als Lehrkraft zur Ehrenbürgerin ernannt.
- Im Jahre 1934 erwirbt Fritz Aigner den Tischlerei-Betrieb Kette.
(Im Jahre 1958 beginnt die Fa. Aigner ihren Möbelbetrieb groß auszubauen, im Jahr 2000 wird der Betrieb geschlossen.) - Im Jahre 1934 eröffnet Franz Sumereder seine Schlosserei (in der Steindorfer Straße).
(Der Betrieb wird 1998 geschlossen.)
1935
- 17.10.1935: Dem Leiter der Volksschule, Oberlehrer Adolf Bocksleitner, wird der Titel „Schuldirektor“ verliehen.
- 23.11.1935: Josef Kirchgatterer, geb. 1905, wird als Gemeindediener und Wachmann angestellt.
- Im Jahre 1935 sind 2044 Fremde (Gäste) gemeldet.
- Das Jahr 1935 ist trocken und zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung muss die Wasserleitung während drei Monaten zeitweise abgesperrt werden.
- 22.12.1935: Das Erweitern der Wasserleitung durch Anlegen eines Tiefbrunnens (Tiefe: 20 m) auf der Parzelle 2047, KG. Seewalchen, wird beschlossen.
Einige Zahlen
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1935: Einnahmen: S 86.578,01 Ausgaben: S 83.891,18 Steuerleistung: Grundsteuer: S 16.035,54; Gebäudesteuer: S 2917,88
Die Jahre 1936 bis 1940
1936
- 4.1.1936: Mit Beschluss des Gemeindetages soll die Kammerbrücke im Einvernehmen mit der Gemeinde Schörfling als „Dollfußbrücke“ benannt werden, gelangt jedoch nicht zur Ausführung.
- 3.3.1936: Anna Hauseder, geb. 1912, aus Kraims wird in der Kellergrube des Johann Renner, Kraims 2, verschüttet und findet hiebei den Tod.
- 19.5.1936: In einem Schreiben an die Gemeindevorstehung Seewalchen bittet die Bewohnerschaft von Steindorf die Aufstellung einer Ortsfeuerwehr zu bewilligen.
Gründungsausschussmitglieder sind:
Franz Neuböck, Josef Sagerer, Karl Krempler und Karl Wiesinger.
Am 14.6.1936 bewilligt der Gemeinderat die Gründung einer Löschgruppe in Steindorf, die Leistung eines Beitrages aus Gemeindemitteln wird jedoch abgelehnt. - Ende des Jahres: 424.000 Arbeitslose. Die Zahl der Ausgesteuerten ist nicht bekannt.
- Im Jahre 1936 errichtet Franz Moser seinen Maßschneidereibetrieb.
- Im Jahre 1936 übernimmt Max Kastinger den elterlichen Betrieb.
1937
- 10.4.1937: Dem Ansuchen des Herrn Pfarrer wegen Leistung eines Beitrages zu den Kosten der Adaptierung des Hauses Nº 28 Seewalchen (Mesnerhaus) für die Errichtung eines Kindergartens wird zugestimmt.
1938
- 25.1.1938: Es wird ein Nordlicht von großer Stärke beobachtet. Von vielen Bewohnern wird dieses Naturereignis als schlechtes Omen gewertet.
- Die wirtschaftliche und politische Lage im Lande hat sich in letzter Zeit verschlechtert. Die Bundesregierung hat für den 13. März 1938 eine Volksbefragung ausgeschrieben. Die Durchführung dieser Volksbefragung wird jedoch durch den am 12. März erfolgenden Einmarsch der deutschen Truppen und die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche verhindert.
- Am 12.3.1938 entsteht in der Lenzinger Papierfabrik ein Großbrand.
13. März 1938
Der gewaltsame Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 13.3.1938 bringt auch für Seewalchen große Veränderungen mit sich.
Es erfolgt die Absetzung des Gemeindetages und am 15.3. die Konstituierung des Gemeindetages der NSDAP mit Georg Meinhart, Bauer in Ainwalchen, als Bürgermeister.
Seit dem Jahre 1809 waren keine fremden Soldaten mehr in Seewalchen.
Niederschrift
aufgenommen am 15. März 1938 aus Anlass der Übergabe
bzw. Übernahme des Vermögens der Gemeinde Seewalchen lt. Inventar I. Das Haus Nº 46 Seewalchen samt zugehörigen Grundstücken im Werte von S 20.000,-- für die Schulgemeinde das Schulhaus Nº 82 in Seewalchen samt zugehörigen Grundbesitz für die Sanitätsgemeinde das Totenhaus im Friedhof 2 Schiffslandungsstege am Attersee: Seewalchen - Litzlberg Kanzleieinrichtung lt. Verzeichnis: S 1.000,-- Summe: S 21.000,-- II. Vermögensausweis Wertpapiere: S 1,04 Int. Forderungen: S 456,34 Wohnbaudarlehen: S 1.950,-- Einlage in der Vorschusskasse: S 5.911,44 Einlage in der Postsparkasse: S 5.957,33 In barem: S 427,77 Summe: S 14.703,92 III Rückständige Umlagen aus 1936 und 1937 Gem. Umlagen 1936: S 199,58 Gem. Umlagen 1937: S 1786,32 Landesabgabe 1936/37: S 115,-- Lustbarkeitsabgabe 1937: S 125,-- Fahrradabgabe 1937: S 33,-- Summe: S 2.258,90 Übergeber: Dachs Johann Übernehmer: Meinhart Georg
- Am 17.3.1938 wird die Wertrelation des österreichischen Schillings zur Reichsmark festgelegt: 1 Reichsmark = 1,50 Schilling.
- Vom 16. bis zum 18.3.1938 sind in Seewalchen Soldaten der SS-Kompanie 'Germania' aus Hamburg mit 35 Offizieren, 190 Unteroffizieren und 658 Mann sowie 144 Pferde einquartiert.
- Am 10. April erfolgt eine Volksbefragung über den Zusammenschluss mit dem Deutschen Reiche. Von 1391 Stimmen werden 1390 mit „ja“ beantwortet.
- 1.5.1938: Gemeindesekretär Max Laminger, der seit September 1906 im Dienste der Gemeinde steht, tritt in den Ruhestand.
- 1.7.1938: In der Ostmark, wie Österreich nun hieß, wird der Rechtsverkehr eingeführt.
- 1.8.1938: Die standesamtliche Trauung wird verpflichtend eingeführt und das Standesamt errichtet. Bis zum 31.12.1938 werden die Trauungen auf der Bezirkshauptmannschaft durchgeführt.
Die Standesämter führen nun die Matriken von Geburten, Eheschließungen und Todesfällen. Bis 1. 1. 1939 wurden diese von den Religionsgemeinschaften geführt. - 17.9.1938: Sitzung des Beirates der N.S.D.A.P in der Gemeinde Seewalchen.
1. Auflösung des Gemeindetages durch den Ortsgruppenleiter und kom. Bürgermeister Pg. (=Parteigenosse) Georg Meinhart,
2. Ernennung des Bürgermeisters Pg. Sepp Häupl durch den Ortsgruppenleiter
3. Im Einvernehmen mit dem neuen Bürgermeister werden Gemeinderäte ernannt.
Am 19.9. legte Bürgermeister Georg Meinhart legt sein Amt zurück, der Gastwirt Josef Häupl wurde sein Nachfolger. - Auf Gründen von Soupper, Leiß und Schreiner (Feldstraße) werden insgesamt 11 Baracken errichtet.
(Diese Baracken waren für den Reichsarbeitsdienst errichtet worden. Nach dem Krieg wohnten dort Flüchtlinge und Heimatvertriebene.)
Der Bau der Reichsautobahn
Mitte 1938 wurde mit den Planungsarbeiten für den Reichsautobahnbau im Bereich Seewalchen begonnen. Die ursprüngliche Planung sah vor, die Trasse über Neißing-Haining und weiter auf halber Höhe des Buchberges an der Seeseite nach Attersee zu führen. Die schwierigen geologischen Verhältnisse machten jedoch eine andere Streckenführung notwendig. Im Bereich des Ortes Seewalchen sollte (anstelle des heutigen Dammes) eine Brücke vom Steindorfer Berg zur „Pürner Rasch“ führen. (Das ist etwas südlicher als die heutige Trassenführung.)
Im November 1938 wurde mit dem Bau der Autobahn (Reichsautobahn München-Salzburg-Wien) begonnen. 50,86 ha landwirtschaftlicher Grund, ein landwirtschaftliches Anwesen („Pointschmied“ Kroiß, das Anwesen stand in der Verlängerung des Kapellenweges Richtung Norden) und 3 Wohnhäuser (in der Hatschekstraße wurden eingelöst bzw. enteignet.
Die Familie Kroiß konnte mit der Entschädigung ein landwirtschaftliches Gut in Pichlwang (Maierhof) kaufen. Bald darauf erfolgte die Entschuldung der Landwirte und der Vorbesitzer hätte sein Anwesen wohl nicht mehr verkauft. Die Einfamilienhäuser Flachberger und Mayrhofer wurden im Müllnerweg (Nr. 7 und 9) neu gebaut.
In Seewalchen und Ainwalchen wurden zur Unterbringung der beim Autobahnbau beschäftigten Arbeiter Barackenlager errichtet.
Zum Transport wurde eine Material-Eisenbahn eingerichtet. Die Remise und das Kohlenlager waren im Bereich der Baracke Haidacherstraße 242.
Die Arbeiten auf der Autobahnbaustelle wurden auch 1939 zügig fortgesetzt. Auch viele Ortsbewohner fanden als Arbeiter auf der Autobahnbaustelle Beschäftigung.
Infolge Kriegsausbruch wurden im September die Erdarbeiten beim Autobahnbau unterbrochen und ab 1.4.1940 in kleinem Umfang mit polnischen Kriegsgefangenen weitergeführt.
Am 1.5.1940 wurden die Arbeiten an der Reichsautobahn eingestellt.
Zwei Brückenbauwerke (im Müllnerweg und nördlich des Amthofes) waren so gut wie fertig, die Erdarbeiten und Dammschüttungen wurden im Bereich Seewalchen nur teilweise ausgeführt. In den folgenden Jahren verwilderte das Gelände.
________________________________________________________________________________________________________
1939
Heimatverband und Staatsbürgerschaft
Mit Jahresbeginn 1939 wurde das Heimatrecht aufgehoben, an seine Stelle trat in der Folge die Staatsbürgerschaft. Bis dahin gehörte jede Person durch Abstammung oder Eheschließung zu einer Gemeinde. Dieses Recht konnte man aber durch langjährigen Aufenthalt in einer Gemeinde „ersitzen." Zuständig war der Gemeindeausschuss.
In beinahe jeder Sitzung des Gemeindeausschusses gab es daher folgende Beschlüsse:
Ansuchen der Frau ... in .... um Aufnahme in den Heimatverband Seewalchen.
Wird mit Rücksicht des 15-jährigen Aufenthaltes in der Gemeinde Seewalchen aufgenommen.
oder
Zum Ansuchen des Herrn .... Hausbesitzer in ... um die Zusicherung zur Aufnahme in den Heimatverband Seewalchen.
Hierüber wird einstimmig beschlossen, die Zusicherung zur Aufnahme in den Heimatverband Seewalchen einstimmig zu erteilen.
Mit dem Heimatrecht hatte man Anspruch auf dauernden und ungestörten Aufenthalt und im Falle von Not war die Gemeinde für die Armenpflege zuständig.
Durch die Errichtung von Standesämtern in der NS-Zeit fiel dieser Heimatverband, an seine Stelle trat der Staatsbürgerschaftsverband.
Umgemeindung

Mit Bescheid der oö. Landeshauptmannschaft Linz vom 27.2.1939 wurde die Gebietsabtretung an die Gemeinde Agerzell (jetzt Lenzing), und zwar die Liegenschaften Pettighofen 1-13, 16, 18-21, 23-34 und 35 sowie Thal Nr. 5 genehmigt.
Die Gebietsänderung trat am 1.5.1939 in Kraft.
Ursprünglich hatte die neue Gemeinde weiterhin den Namen Oberachmann, am 1.1.1940 wurde der Name in „Agerzell“ geändert, ab 1.6.1948 erhielt die Gemeinde den Namen „Lenzing“.
1939 hatte diese Gemeinde 900 Einwohner, am 1.1.1940 bereits 2730 Einwohner.
Die Gemeinde Seewalchen wies mehrfach, unter anderem beim Landrat Vöcklabruck sowie beim Gauleiter auf die großen wirtschaftlichen Nachteile hin, die durch diese Abtretungen entstanden sind. Besonders wurde erwähnt, dass der Verlust des einzigen Industriebetriebes (Pettighofen) und der Zuzug von arbeitsuchenden „Volksgenossen“ das ohnehin traurige Bild noch verstärke. Auch der Sommerfrischenverkehr habe einen niemals geahnten Tiefstand erreicht. Der Verlust der Gemeindeeinnahmen wurde mit jährlich 7.000 RM beziffert.
Die Gemeinde forderte daher unter anderem einen Teil der Lohnabgaben der neuen Fabrik, sowie dass die Beamtenwohnungen der neuen Fabrik in Seewalchen gebaut würden.
Es gab eine Reihe von Verhandlungen, unter anderem forderte die Gemeinde monatlich 500 RM von der Zellwolle. Obwohl man die Wünsche Seewalchens verstand, wies man aber seitens der Behörden auf die Tatsache hin, dass die Gemeinde Seewalchen praktisch schuldenfrei sei. Für eine Entschädigung sei dann die direkte Auseinandersetzung zu suchen.
Kurzzeitig gab es auch den Plan, die Gemeinde Seewalchen in die Gemeinde Agerzell einzugemeinden. Der Seewalchner Bürgermeister ließ dem Gauleiter in Linz zehn unverbindliche Vorschläge übermitteln, wo im Falle der Eingemeindung die Mindestforderungen Seewalchens an die Gemeinde Agerzell (Lenzing) formuliert wurden. Diese Idee kam nie zur Durchführung.
________________________________________________________________________________________________________
- 21.7.1939: Ein Hagelwetter vernichtet einen Großteil der Getreide- und Obsternte im Gemeindegebiet Seewalchen.
- Durch Gäste aus Deutschland (KDF-Reisen) hat der Fremdenverkehr starken Aufschwung genommen.
- 1.9.1939: Mit dem Einmarsch der deutschen Armee in Polen beginnt der 2. Weltkrieg.
Die Lebensmittelbewirtschaftung (Lebensmittelkarte und Kleiderkarte) wird für das Deutsche Reich einschließlich der Ostmark angeordnet.
Auf den Grundstücken in Pettighofen, die vor der Grenzänderung zur Gemeinde Seewalchen gehörten, wird die Werkssiedlung errichtet. - 10.12.1939: Bei einem Bahnübergang in Lenzing kommt es zu einem Zusammenstoß eines Busses mit Schichtarbeitern und dem Zug. 19 Tote sind zu beklagen.
- 30.12.1939: Barackenbrand in Ainwalchen.
- Im Jahre 1939 beginnt Max Kastinger erstmals mit der industriellen Schuhfertigung.
- Im Jahre 1939 eröffnet die Bäckerei Oberndorfer ihren Betrieb.
- Im Jahre 1939 stellt die Papierfabrik Pettighofen ihren Betrieb ein.
1940
- 1.5.1940: Die für den Autobahnbau eingesetzten polnischen Kriegsgefangenen werden für landwirtschaftliche Arbeiten herangezogen.
- Die Einberufung der wehrfähigen Männer wird fortgesetzt.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1940: Einnahmen: 243.625,80 RM Ausgaben: 225.873,27 RM
| Chronik der Marktgemeinde Seewalchen |
|---|
1850 - Beginn der Aufzeichnungen - Übersicht 1851-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 |
Die Jahre 1941-1945
1941
- 30 französische Kriegsgefangene werden im Lager der Autobahnbaracken, (später im Amthof) untergebracht und den Landwirten zu Arbeiten zugeteilt.
- 22.6.1941: Es beginnt der Krieg Deutschland gegen Russland.
Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und sonstigen Verbrauchsgütern wird immer schwieriger. Einerseits müssen die wehrfähigen Männer aus der Landwirtschaft und dem Gewerbe zur Wehrmacht einrücken, andererseits werden die Ablieferungsquoten erhöht.
1942
- Auf den strengen Winter 1941/42 bei 1 Meter hohen Schneebelag und Temperaturen bis zu 28° Kälte folgt ein heißer Sommer mit 46° Wärme (?) an einigen Tagen.
1943
- Die Gaststätten Seehof Litzlberg, Gasthof Häupl und der Amthof werden als Kinderlandverschickungslager eingerichtet. Es kommen Kinder aus den deutschen Städten zur Erholung.
- Frauen und Kinder aus den bombengefährdeten Städten Deutschlands (Düsseldorf, Krefeld, Berlin) werden in die noch leerstehenden Sommerhäuser einquartiert.
1944
- Mit Beginn des Jahres 1944 setzt der grausame Luftkrieg gegen die Heimat ein. Die Nacht vom 24. auf 25. Jänner ist von Lenzing bis Attnang durch x-hundert Leuchtbomben (sogenannte Christbäume) zum Tage gemacht. Bomben werden abgeworfen, fallen aber in den See.
- 24.2.1944 (24.1.?): Feindliche Flieger überfliegen unseren Ort und werfen Leuchtraketen sowie im weiteren Umkreise auch Sprengbomben ab.
- An Stelle der zur Wehrmacht eingerückten Seewalchner Bauern arbeiten in der Landwirtschaft Ukrainer, Polen, Griechen, Kroaten und französische Kriegsgefangene.
- 10.4.1944: Über Auftrag der Behörde wird begonnen, das Kirchturm-Kupferdach abzunehmen. Es soll eingeschmolzen werden und für militärische Zwecke Verwendung finden.
Im April begann die Einrüstung des Turmes durch einen Zimmermeister. Ab September erfolgte die Neueindeckung mit verzinktem Eisenblech.
Das Kupferblech blieb aber infolge der Wirren der letzten Kriegstage liegen und wurde nicht mehr abtransportiert. Nach dem Krieg wurde es von einem örtlichen Altwarenhändler abgeholt, der es verkaufte. - 10.7.1944: Über dem Gemeindegebiet geht ein schweres Unwetter mit Hagelschlag nieder. Solche Katastrophen wirken sich besonders nachteilig aus, weil die Landwirte kaum ihrer Verpflichtung zur Ablieferung der landwirtschaftlichen Produkte nachkommen können.
- Für Flüchtlinge aus Rumänien, Ungarn und Jugoslawien werden Notquartiere, sogenannte Erdhütten, im Bereiche Buchberg und Unterbuchberg errichtet.
- Im Dezember gibt es einen Luftkampf über dem Attersee. Amerikanische Flieger werden abgeschossen, einer stürzt in den See und einer oberhalb von Unterbuchberg in den Wald.
Ein Bombenabwurf hat vermutlich den Erdhütten in Unterbuchberg gegolten, aber die Bomben verfehlen das Ziel und fallen in den Wald. - 12.12.1944: Der Schulbetrieb wird eingestellt. Der Jahrgang 1938 muss 1945 noch einmal mit der Schule beginnen.
1945
- 21.4.1945: Attnang wird bombardiert. 700 Tote, wobei nur 208 namentlich festgestellt werden konnten (darunter auch eine Seewalchner Bürgerin). 120 Wohnhäuser werden total zerstört, 276 Wohnhäuser beschädigt, 356 Wohnungen sind unbrauchbar. Allein an den Häusern werden 5 Mio. Reichsmark Schaden festgestellt.
Auch die Feuerwehr Seewalchen ist 3 Tage im Einsatz. - 27.4.1945: Die Republik Österreich ist wieder als selbständiger Staat entstanden.
- Kurz vor Kriegsende wurden ungarische SS-Einheiten in Seewalchen einquartiert. Am 4. Mai hat die Kampftruppe im Raum nördlich des Ortes Seewalchen Stellung genommen. Die Agerbrücke wurde zur Sprengung vorgesehen. Nach Verhandlungen des Bgm. Häupl mit dem Kommandanten der SS-Einheiten wurde die Stellung vor den anrückenden amerikanischen Truppen aufgegeben. Die ungarische SS ist unter Mitnahme von Pferdefuhrwerken, die die Seewalchner bereitstellen mussten, in Richtung Grünau im Almtal abgezogen.
Das Gerücht, dass die Brücke vermint sei, hielt sich in der Bevölkerung nachdrücklich. Als die Amerikaner kamen, musste der Bürgermeister (beobachtet von einem amerikanischen Spähwagen) allein über die Brücke gehen.
Das Depot
In der Autobahnunterführung (Müllnerweg) befand sich ab ca. 1943 ein Warenlager der Wehrmacht, welches unter dem Befehl der Marine-Infanterie stand. Beide Seiten der Durchfahrt waren mit Brettern verschlagen, am südlichen Ausgang war ein Raum für Wachesoldaten.
Das Depot enthielt unter anderem Stoffe, Wäsche, Handtücher, Seifen, Perserteppiche, Schreibmaschinen, Bleche, Radioapparate, Elektromotore, aber auch Sattlermaschinen und Fahrzeuge.
Munition oder Kriegsgerät war nicht in der Durchfahrt, sondern befanden sich in einer Hütte etwas weiter südlich (heute Müllnerweg). Kurz vor dem „Zusammenbruch“ zogen die deutschen Soldaten ab und das Lager war für ein paar Tage herrenlos.
Der Bürgermeister und einige NS-Verantwortliche wollten nun am 4. Mai 1945 die Waren an die Bevölkerung verteilen. Da plötzlich das Gerücht auftauchte, man hätte schon die Amerikaner am Schlosserberg gesehen, brach jede Organisation zusammen und die Bevölkerung plünderte das Lager.
Die Amerikaner, die am nächsten Tag kamen, ordneten in der Folge an, dass die Waren zum Gemeindehaus gebracht werden müssen. Die Bevölkerung kam dieser Anordnung jedoch nur sehr zögerlich und auch nur teilweise nach. Die abgegebenen Gegenstände fanden wiederum das Interesse der Bevölkerung und wurden von dort erneut nach Hause getragen.
Die Befreiung
Am 5. Mai 1945 um 18.00 Uhr fahren von Gampern kommend amerikanische Panzer in Richtung Seewalchen. In der Ortschaft Steindorf wird der polnische Landarbeiter Oleska Federenko erschossen. Von den einmarschierenden Truppen werden einige Schüsse in den Ort abgefeuert. Im Hause Eder, Seyrlstraße 4, entsteht durch eine Brandgranate ein Brand. Der Feuerwehrkommandant Franz Sumereder wird auf dem Weg zum Brandplatz von amerikanischen Soldaten angeschossen und am Arm verletzt.
Die Häuser mussten eine weiße Fahne hießen, ein Leintuch wurde an einer Stange befestigt und über den Dachfirst geschoben.
Inzwischen wurde von einer Abordnung unter der Führung von Bgm. Häupl der Ort Seewalchen den amerikanischen Truppen übergeben.
Bei der Besetzung Seewalchens werden von den amerikanischen Truppen 2 deutsche Soldaten und 2 Zivilpersonen erschossen.
Zur Einquartierung der amerikanischen Soldaten müssen viele Bewohner in Seewalchen ihre Wohnungen zur Verfügung stellen.
Die Unterbringung dieser Bewohner in anderen Wohnungen ist sehr schwierig, weil die Sommerhäuser und die Baracken bereits mit Flüchtlingen aus Deutschland, aus dem östlichen Raume Österreichs, aus Ungarn, Jugoslawien, Polen und Tschechei besetzt sind.
Südlich des Friedhofes ist die amerikanische Armee untergebracht. Auf der „Pfarrer-Broaten“ wird ein Flugplatz eingerichtet.
Die französischen Gefangenen im Amthof feiern diesen Tag bis in die Nacht.
________________________________________________________________________________________________________
- 18.5.1945: Der von den Nationalsozialisten abgesetzte Bürgermeister Johann Dachs, Ainwalchen, wird von der Militärregierung wieder in sein Amt eingesetzt.
- Über Auftrag der Militärregierung müssen für 37 Personen aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen Quartiere bereitgestellt werden. Sie werden in der Villa der Frau Wallace-Curzon, Litzlberg 28, untergebracht.
- 2.6.1945: Ehemalige nationalsozialistischen Funktionäre werden von der amerikanischen Militärpolizei in das Anhaltelager Glasenbach bei Salzburg gebracht.
- 7.6.1945: Der Ehrenbürger und Zahnarzt Dr. Rudolf Schuh stirbt.
- Der Schuldirektor Adolf Bocksleitner wird als Leiter der Volksschule wegen Zugehörigkeit zur NSDAP enthoben. An seine Stelle folgt am 21.11.1945 Oberlehrer Martin Wehinger.
- 26.7.1945: Der Feuerwehrwagen Mercedes, Baujahr 1911, wird der Löschgruppe zur Verfügung gestellt.
- 14.8.1945: Zur Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Belange im Gemeindegebiet werden folgende Kraftfahrzeuge eingesetzt:
Personenkraftwagen: 12, Lastkraftwagen: 12, Feuerwehrfahrzeuge: 4, Motorräder: 15, Traktoren: 2.
Bewohner 1945
- Gesamtübersicht der in der Ortschaft Seewalchen untergebrachten Flüchtlinge:
- Ausländer 538 Personen
- Ausländer im Lager 550 Personen
- Österreicher 1255 Personen
- Deutsche 411 Personen
- Summe: 2754 Personen
- Stand der hiesigen Bevölkerung 2500 Personen
- Gesamt: 5254 Personen
- In den bestehenden Unterkünften (Lager) sind untergebracht:
- Erdhüttenlager Buchberg 51 Personen
- Auffanglager (Stallinger-Saal) 17 Personen
- Sammelbaracken (Autobahnbaracken) 522 Personen
(August 1945)
________________________________________________________________________________________________________
- 1.10.1945: An Stelle von P. Dr. Heinrich Scharl wird P. Sieghart Wuppinger als Pfarrer installiert.
- 8.10.1945: Die Identitätskarte in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache und für alle Österreicher wird von den Besatzungsmächten angeordnet.
- 19.10.1945. Im Haus Seewalchen 200 (Ploner) bricht ein Brand aus.
- 25.11.1945: Gemeindeausschusswahlen: SPÖ: 37,4% (9 Mandate), ÖVP: 60,8% (15 Mandate)
- 13.-20.12.1945: Erste Währungsreform in Österreich. Der Schilling wird wieder gesetzliches Zahlungsmittel. Die Reichsmark und der „Alliierte Militärschilling“ werden 1:1 umgetauscht. Pro Person wurden 150 Reichsmark umgetauscht, der Rest kommt auf Sperrkonten.
- Die Toten des zweiten Weltkrieges:
Im Zweiten Weltkrieg mussten 397 Männer der Gemeinde Seewalchen zur Wehrmacht einrücken. Gefallen sind 77 Wehrmachtsangehörige und 3 Zivilpersonen. Als vermisst gelten 37 Wehrmachtsangehörige. - Über 2.000 Flüchtlinge aus dem Burgenland, Niederösterreich sowie in östlichen Staaten halten sich gegen Jahresende in Seewalchen auf.
Das Barackenlager in der Feldstraße ist überfüllt. Die Bevölkerung ist auf 7246 gestiegen.
Viele abgerüstete Soldaten und Flüchtlinge suchen bei den Bauern Arbeit.
Rechnungsabschluss 1945: Einnahmen: S 102.776,53 S Ausgaben: S 73.876,62 S
Die Jahre 1946-1950
1946
- 4.3.1946: Das Ehepaar Kroiß erwirbt den „Litzlberger Keller“.
- 1.4.1946: Die von der Gemeinde nach Kriegsende aufgenommenen Hilfspolizisten werden entlassen.
- Im Laufe des Monats Mai 1946 muss der Kaloriensatz des Normalverbrauchers abermals, nun von 1500 auf 800 bis 900 Kalorien herabgesetzt werden.
- 28.5.1946: Erstmals werden Kartoffelkäfer festgestellt. Es wird ein Suchdienst angeordnet.
- 30.5.1946: Brand im Flüchtlingslager Seewalchen.
- 1.6.1946: Felix Brand wird als Gemeindebediensteter aufgenommen.
- Die Musikkapelle Seewalchen wird wieder ins Leben gerufen.
Unglück im See
Am 28. Juli 1946 entschlossen sich 5 junge Steindorfer zum „Schifferl fahren“, also zu einer Bootsfahrt am See und leihten sich dazu „beim Hasse“ (heuteStrandbad) ein Ruderboot aus. Am See machten sich einige amerikanische Besatzungssoldaten einen Spaß mit den jungen Leuten, indem sie mit ihrem Motorboot das Ruderboot immer wieder umkreisten und so dieses in heftige Schaukelbewegungen setzten. Schließlich kam es zu einer Kollision, bei der beide Boote beschädigt wurden. Während die Soldaten sofort gerettet wurden, mussten die Steindorfer, allesamt Nichtschwimmer, warten. Zu allem zog auch ein Unwetter auf und das Boot mit den Leuten kenterte. Dabei kam die 26-jährige Marianne Krempler, Seppenbäurin in Steindorf, ums Leben. Ihr Mann entrann nur knapp dem Tod.
Nach 1-wöchiger Suche konnte die Leiche von Franz Mittendorfer in der Nähe des Kinderbades gefunden werden.
Franz Krempler heiratete später die Schwester der Verunglückten.
________________________________________________________________________________________________________
- 24.8.1946: Bgm. Johann Dachs legt sein Amt zurück. Schmiedemeister Josef Frickh (ÖVP) wird zum Bürgermeister und der Bahnbedienstete Karl Oktabec (SPÖ) wird zum ersten Vizebürgermeister, Martin Wehinger (ÖVP) zum 2. Vizebürgermeister gewählt.
- Im Jahre 1946 wird ein Teil der Flüchtlinge über Auftrag der Militärregierung in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Für die Flüchtlinge aus Rumänien und Jugoslawien gibt es jedoch kein zurück, sie müssen im Reichsautobahnlager Seewalchen bleiben.
- 19.10.1946: Die Errichtung einer Wäschefabrik durch Frau Irene Sommer in Gerlham (Hainingerbach) wird abgelehnt, weil eine Industrie mit ihrem Anhang im Interessengebiet des Fremdenverkehrs die Sommerfrische schädigen würde.
- Ab November 1946 führt Frieda Roither (bis 1978) eine Gemischtwarenhandlung (Hauptstraße 4).
- Max Kastinger, Seewalchen 127, beginnt mit dem Ausbau des Betriebes zur Schuherzeugung.
1947
- Durch eine unerhörte Trockenheit im Sommer kommt es zu einer Missernte, auch viele Brunnen im Gemeindegebiet sind ausgetrocknet.
- 26.8.1947: Der Gemeindeausschuss hat angeordnet, die Bäckermeister sollen nur im Rahmen der Möglichkeiten an Auswärtige Brot verkaufen, damit die Versorgung der Ortsbewohner nicht gefährdet sei.
- Im September wird ein ausgesprochener Niedrigwasserstand mit einem Pegelstand von 94 cm (Mittelstand: 141 cm) festgestellt.
- 2.9.1947: Im Haus Gamerith in Unterbuchberg bricht ein Brand aus.
- Im September 1947 wird im Gasthaus Schönauer, Kammer, der Schiklub Kammer gegründet. Im Dezember wird im Gasthaus Rosenauer, Seewalchen, die erste Hauptversammlung abgehalten.
Der Name „Kammer” wurde gewählt, weil es der Mittelpunkt zwischen Seewalchen und Schörfling ist.
Im Jänner 1948 wurden die ersten Vereinsmeisterschaften („Gahberglauf”) abgehalten.
Die Sieger: Damen: Edith Seifert; Herren: Rudolf Lachinger; Jugend: Sepp Staudinger; Max Mayr wird Landesmeister der alpinen Kombination. - 12.9.1947: Der erste Heimkehrertransport aus Russland trifft in Wiener Neustadt ein. Zugunsten der Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft wird von den Gemeindevertretern eine Geldsammlung durchgeführt.
- 14.10.1947: In der Sitzung des Gemeindeausschusses wird das Bauansuchen der Fa. Klinger aus Niederösterreich zur Errichtung einer Straße für das Arbeitererholungsheim bewilligt.
Das Heim befand sich im Bereich der heutigen Teichstraße. Die Straße führte von der Abzweigung des Knäulbergs (Zufahrt zu Häusern Reichersberger Straße 2-4) durch den Wald Richtung Häupl-Eisteich und führte dann zum Ferienheim
Das Heim bestand bis Anfang der 1960er Jahre.
1948
- 18.2.1948: Herr Bürgermeister bringt einen Bericht über den schlechten Zustand des Seewalchnerberges (Kastinger) [heute Hauptstraße] sowie das Schreiben an die Landesbaudirektion betreffs Pflasterung zur Kenntnis. Die Notwendigkeit wird vom Gemeindeausschuss erkannt und die Pflasterung mit Granitsteinen einstimmig befürwortet.
- 8.6.1948: Karl Oktabec legt sein Amt als Vizebürgermeister zurück. An seine Stelle wird der Fabriksarbeiter Alois Hemetsberger gewählt.
- Im Jahre 1948 übersiedelt die Gebietsbauleitung der Wildbachverbauung von Attersee zum ständigen Aufenthalte in die eigens errichteten Gebäude in Seewalchen mit Belegstand von 100 Personen.
- Auf den Pfarrgründen am See wird gegen einen jährlichen Pachtschilling von S 100 ein Kinderbad mit Kosten von S 10.000 errichtet.
- Bis 1.10.1948 wird im Mesnerhaus ein Pfarrkindergarten geführt. Wegen zu hoher Kosten wird er aufgegeben.
- Der Heldenfriedhof wird nach Plänen des Arch. Josef Zotti, Seewalchen, errichtet.
1949
- 11.1.1949: Die Brot- und Mehlrationierung wird aufgehoben.
- Im Frühjahr 1949 wird die Durchfahrt (Autobahnviadukt Müllnerweg) für den Verkehr geöffnet.
Zuerst war sie Warenlager, dann einige Zeit Garage für die Molkerei Kolm. Der Verkehr wurde über eine eigene Straße im Osten an der Durchfahrt umgeleitet. - 11.8.1949: Bgm. Frickh legt krankheitshalber sein Amt zurück.
Am 12.9.1949 wird Martin Wehinger zum Bürgermeister gewählt. - 30.9.1949: P. Gerhard König wird als Pfarrer installiert.
- 9.10.1949: Gemeindeausschusswahlen: ÖVP: 40,3%(10 Mandate), SPÖ: 27,3% (6), WdU: 31,9% (8), KPÖ: 0,5% (0).
- 27.11.1949: Abschluss der regelmäßigen Heimkehrertransporte aus der Sowjetunion.
- Im Jahre 1949 beginnt das Ehepaar Tostmann mit der Herstellung von Trachten.
1950
- 7.1.1950: Der Gemeindeausschusses bewilligt für die Errichtung von 15 Siedlungshäusern in der Feldstraße und J.-Wimmer-Straße ein Darlehen von S 50.000,--.
- Für den Bürgermeister steht eine Aufwandsentschädigung von S 1,10 pro Einwohner und Jahr zu.
- Im Gemeindeamtshaus Hauptstraße 1 wird das Postamt untergebracht. Für das Gemeindegebiet (ausgenommen die Ortschaften Haidach, Pettighofen und Unterbuchberg) erfolgt nun die Postzustellung vom Postamt Seewalchen aus.
Vorher erfolgte die Postzustellung vom Postamt Kammer. - 7.6.1950: Brand in der Waldvilla (heute Waldweg).
- Am 17.7.1950 wird bei Planierungsarbeiten neben der Villa Stallinger, Seewalchen 60 (Eingang der Promenade), in einer Tiefe von 25 cm ein römischer Schatz, mutmaßlich aus dem Jahre 200 n. Chr. gefunden.
Die Gegenstände befinden sich im Heimathaus Vöcklabruck. - 18.8.1950: Die Fleischhauerei Zehetner eröffnet in Seewalchen eine Filiale.
Diese wird von Hans Pieringer geführt. Pieringer errichtete Mitte der 50er Jahre das Geschäft am Schulweg 1, das bis 1987 geöffnet war. - 31.8.1950: Ende der Rationierungen, das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz wird außer Kraft gesetzt.
- 19.9.1950: Der Schriftsteller und Lyriker Franz Karl Ginzkey, Atterseestraße 96, wird für seine Verdienste als Schriftsteller zum Ehrenbürger ernannt.
- 19.9.1950: Der Gemeindeausschuss hat den Ankauf der Boots- und Badehütte der Frau Andorff-Westen (heute Strandbad) beschlossen.
Im Oktober wird beschlossen, diese dann meistbietend zu verkaufen.
Die Gemeinde plant die Errichtung einer modernen Badeanstalt, da das sogenannte Hassebad nicht mehr den Fremdenverkehrsanforderungen entspricht. - 30.9.1950: Die Frw. Feuerwehr Seewalchen wird beim 1. Landesfeuerwehrwettbewerb in Mattighofen Landessieger.
- 1.10.1950: Der Gemeindeangestellte Franz Baumgartinger wird in den Dienst der Gemeinde aufgenommen.
- 17.11.1950: Der Gemeindeausschuss hat der Errichtung des Friedhofes durch die Pfarre Lenzing in Haidach zugestimmt.
- Im Jahr 1950 wird im Kleinmüllergarten (Eingang Promenade, heute Blumen Mayer) mit dem Betrieb einer „Milchtrinkhalle“ durch Grete Polagnoli begonnen.
Rechnungsabschluss 1950: Einnahmen: S 989.872,66 Ausgaben: S 633.602,35
Die Jahre 1951-1955
1951
- 24.2.1951: Der Gemeindeausschuss beschließt eine jährliche Bürgermeisterentschädigung von ca. S 5500,--.
- 4.5.1951: Hedy Lachinger eröffnet ihren Damen-Friseur-Salon im Haus des Friseurs Rudolf Hemetsberger.
- 29.6.1951: 18 Musiker unter Georg Lingner gründen im Barackenlager in Kammer die „Siebenbürger-Kapelle Kammer a.A.”
Daraus entsteht die Musikkapelle Rosenau. - 4.7.1951: Am Zubau des Amthofes entsteht durch spielende Kinder ein Brand, der die Dachung vernichtet.
- 8.7.1951: Infolge Blitzschlag brennt der Heustadl des Herrn Mayr, Seewalchen 49 (Hauptstraße 7), ab und vernichtet die Heuvorräte.
- Der Güterweg Reichersberg zwischen Autobahnunterführung und der Ortschaft Reichersberg wird ausgebaut.
- Von 1950-1951 wird die Umfahrungsstraße Seewalchen zwischen Seewirt und Litzlberger Keller ausgebaut.
Mit dem anfallenden Aushubmaterial wird die Promenade im Bereich Promenadeneingang bis Strandbad verbreitert. - 1.12.1951: Da vier Familien delogiert werden und somit dringend eine Wohnung brauchen, beschließt der Gemeindeausschuss eine Baracke zu errichten. Schließlich wird ein entsprechendes Grundstück an der Haidacher Straße (Nr. 242) gekauft.
- 30.12.1951: Infolge Brandlegung brennt das Auszughaus des Georg Schachl in Ainwalchen ab.
- Im Jahr 1951 wird Anna Kraft als Gemeindebedienstete aufgenommen.
- 1951 wird der Verschönerungsverein (von 1897) aufgelöst und eine Fremdenverkehrskommission bestellt.
1952
- Anfangs Jänner kommt es durch starken Schneefall zu Verkehrsstörungen. Schneeschaufler sind über 5000 Stunden zur Räumung der Straßen eingesetzt.
- 7.2.1952: Der Schriftsteller Rudolf Hans Bartsch, früher Besitzer der sogenannten Bartsch-Villa, Schulweg (heute Dr.-R.-Schuh-Str. 9), stirbt in Graz.
- 14.4.1952: Durch Brandlegung entsteht im Anwesen des Georg Meinhart, Ainwalchen 4 ein Großbrand, dem der Dachstuhl des Hauses und das Wirtschaftsgebäude sowie sämtliches Inventar und teilweise der Viehstand zum Opfer fallen.
- 30.5.1952: Fritz Neuhofer eröffnet eine Gemischtwarenhandlung (Hauptstraße 14). (Sie besteht bis 1984.)
- 27.7.1952: Die Umfahrungsstraße Seewalchen (HAGE-Bank bis Esso) wird ihrer Bestimmung übergeben.
(Zuvor führte der gesamte Verkehr Richtung Attersee durch die Hauptstraße.) - 2.9.1952: Zu Ehrenbürgern werden
Prof. Dr. Karl Häupl: Professor und Rektor der Kieferklinik Düsseldorf und
Dr. Fritz Seifert: Gemeinde- und Wehrarzt, ernannt. - 7.9.1952: Der 17-jährige Bauernsohn Mathias Ebetsberger aus Gerlham 14 ertrinkt bei Moos im Attersee infolge Umkippens eines mit 7 Personen besetzten Bootes.
- 22.10.1952: Der Gemeindeausschuss genehmigt, den Abverkauf des ehem. Kinderbades (Umkleidekabinen) an Karl Hinterdorfer.
Weiters wird der Ankauf der Goldbergwiese beschlosssen. (Es wurde die Meinung vertreten, dass hier durch die Errichtung eines Campingplatzes der Fremdenverkehr gehoben werden würde.) - Im Jahre 1952 wird in Litzlberg das erste Jugend-Rotkreuzheim, ein einfacher Holzbau, errichtet.
1953
- 26.5.1953: In Weyregg wird beschlossen, einen Attersee-Fremdenverkehrsverband zu gründen. Am 2.6.1953 werden in Seewalchen die Satzungen dieses Verbandes beschlossen, Erich Soupper wird zum Obmann gewählt.
- 15.6.1953: Da die Sonn- und Feiertage zur Abwicklung der Geschäfte der Raiffeisenkasse nicht mehr ausreichen, wird der Tagesverkehr eingeführt.
Veränderungen
Die Zeit ab 1950 war durch gewaltige Veränderungen gekennzeichnet. In der Landwirtschaft setzte eine starke Technisierung ein, immer mehr verdrängte der Traktor das Pferd. Gleichzeitig nahm die Zahl der Landarbeiter stark ab.
Die Industriebetriebe Zellwolle und Papierfabrik Lenzing sowie die Schuhfabrik Kastinger zogen immer mehr Menschen von der Landwirtschaft ab. Eine vorher nie gekannte Motorisierung setzte ein. Die guten Verdienstmöglichkeiten machten die Anschaffung eines Motorrades oder eines Autos für weiteste Kreise der Bevölkerung möglich. Während es vor 1950 nur ganz wenige Autos in Seewalchen gab, wurde dieser einstige Luxusartikel Gegenstand des täglichen Gebrauchs. Damit war auch die Eröffnung mehrerer Tankstellen verbunden.
Die Bautätigkeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch viele Arbeiter konnten sich ein Einfamilienhaus errichten. Von 1950-1953 wurden 93 Bauvorhaben ausgeführt.
Die Zahl der Sommergäste ist ebenfalls wesentlich angestiegen. Waren es 1950 noch 1737 Gäste, so stieg im Jahre 1953 die Zahl bereits auf 3509.
________________________________________________________________________________________________________
- Ab November 1953 führt die Familie Lachinger eine Gemischtwarenhandlung (Müllnerweg 1, bis 1985).
Anfänglich war auch ein Kohlenhandel beim Geschäft, daneben wurde Milch aus der Molkerei Kolm verkauft. - Im Jahre 1953 wird der Wasserskiclub Seewalchen a.A. gegründet.
1954
- Der Attersee ist von Ende Jänner bis Ende März zugefroren.
- Die Schneeschaufler auf der Gamperner und Neißinger Bezirksstraße erhalten einen Stundenlohn von S 4,--. Gesamt dürften rund S 4.500,-- ausgegeben worden sein.
- Der Gastgewerbekonzession der Rosa Kettinger steht der Gemeindeausschuss ablehnend gegenüber, weil er keinen Bedarf für ein weiteres Cafehaus erkannte.
(Das Lokal nördlich der Werkstätte Lenzenweger im Aussichtsweg wurde schließlich aber doch errichtet.) - 16.5.1954: Einweihung des Jugendheimes „Segelboot“ in Moos.
- Am 22.5.1954 hat Bgm. Martin Wehinger sein Mandat wegen Parteidifferenzen zurückgelegt. Vzbgm. Josef Gebetsberger, Bauer in Litzlberg, wird zum Bürgermeister, der Baumeister Johann Ploner zum Vizebürgermeister gewählt.
- Nachdem im Jahre 1953 die Pfarrkirche Seewalchen außen gründlich renoviert wurde, wird im Jahr 1954 auch das Innere des wertvollen Baues durch die Firma Watzinger aus Salzburg geschmackvoll erneuert. Am Gewölbe des Altarraumes werden die alten Ornamente von 1481 mit Inschrift und Meisterzeichen freigelegt. Der Triumphbogen zeigt die Zahl 1486.
- 8.-10.7.1954: Das Jahr 1954 ist ein ausnahmslos nasses Jahr und infolge dessen entsteht auch Hochwasser. Der See ist aus dem Ufer getreten und in Buchberg, Moos und Seewalchen stehen mehrere Häuser unter Wasser. Am 10.7.1954 kommt es in Unterbuchberg infolge des anhaltenden Regens zu einem Bergrutsch. Die zur Wiener Villa gehörige Garage wird 10 m Richtung See geschoben. Geröll, Erdmassen und Bäume verlegen die Attersee-Bundesstraße ca. 5 m hoch. Der Verkehr ist für mehrere Tage unterbrochen.
- 13.7.1954: Gründung der evangelischen Pfarrgemeinde Lenzing-Kammer.
- 21.8.1954: Schuldirektor i.R. Adolf Bocksleitner wird für sein Heimatbuch (1929), dessen Gesamterlös für die Kirche bestimmt war, und seine Tätigkeit in der Raiffeisenkasse (deren Kassenleiter er von 1929-1953 war) zum Ehrenbürger ernannt.
- Die Frw. Feuerwehr ist mit 23 Booten der Bootsvermietung Neuhofer (heute Strandbad) in Goldwörth und Walding an der Donau im Hochwassereinsatz.
- Im Herbst 1954 wird zur Errichtung der Schuhfabrik Kastinger bzw. der LAWOG-Häuser ein Grundstück an der Steindorfer Straße angekauft.
- 11.11.1954: Pfarrer Mathias Schuster schildert dem Gemeindeausschuss die Situation der Lagerinsassen. Um diesen Übelständen abzuhelfen, ist geplant auf den Gründen des Ignaz Rosenauer hinter der Bahnhaltestelle Siebenmühlen Siedlungshäuser zu errichten.
Dazu wird ein entsprechender Teilbebauungsplan erstellt und angenommen. Wie der Bürgermeister betont, werde die Gemeinde die Siedlungswerber größtmöglich unterstützen. Die Siedlung soll jedoch ein Teil des Ortes Seewalchen bleiben und nicht als eigene Ortschaft. - Dem Ansuchen der Freiw. Feuerwehr um Überlassung des Tennisplatzes wird einstimmig zugestimmt. Der Tennisplatz, früher vom Fremdenverkehrsverband betrieben, wird nicht mehr gebraucht.
- Im Jahr 1954 wird die Konzession Mittendorfer von Seeplätten auf LKW ausgeweitet.
1955
- 25.1.1955: Das Seewirtshäusl, heute etwa der Platz Bushaltestelle an der Brücke nach Kammer, wird für den Ausbau der Attersee-Bundesstraße enteignet.
- 1.5.1955: Karl Russ übernimmt das Friseurgeschäft in der Kirchengasse (Hauptstraße 4).
- 15.5.1955: Nachdem er bereits seit 10 Jahren in Kammer gewirkt hat, wird Mathias Schuster zum neuen Pfarrer der Gemeinde Lenzing-Kammer geweiht.
- 29.6.1955: Die Elektrifizierung der Kammerer Bahn ist abgeschlossen.
- 1.7.1955: Gemeindearzt Dr. Fritz Seifert geht in Pension, sein Sohn Dr. Günther Seifert wird als neuer Gemeindearzt bestellt.
- 25.7.1955: Für die 1939 eingemeindeten Gebiete erhält die Gemeinde Seewalchen von der Gemeinde Lenzing eine Entschädigung von S 150.000.
- 30.9.1955: Hubert Grausgruber, Roitham, wird zum Postamtsleiter bestellt.
- 23.10.1955: Gemeindeausschusswahlen: ÖVP: 608 Stimmen (10 Mandate), SPÖ: 568 (10), FPÖ 127 (2), UP: 158 (2).
(UP=Unabhängige Partei [Köstler]) - 14.11.1955: Nach dem Ergebnis der Wahlen werden gewählt:
Bürgermeister: Josef Gebetsberger, Litzlberg (ÖVP),
1. Vizebürgermeister: Ferdinand Lampersberger, Seewalchen (SPÖ),
2. Vizebürgermeister: Ignaz Rosenauer, Seewalchen (ÖVP), - 10.12.1955: Mit dem Besitzer des Seebades (ehem. Neuhofer-Bad, auch Hassebad) werden wegen Kauf der Badeanstalt Verhandlungen geführt. Die Planung für einen Badneubau wird in Auftrag gegeben.
- Im Jahre 1955 eröffnet Heinrich Rohringer seinen Konditoreibetrieb in der Hauptstraße.
Rechnungsabschluss 1955: Einnahmen: 2,405 Mio. S Ausgaben: 2,213 Mio. S
Die Jahre 1956-1960
1956
- 17.1.1956: Hubert Hofer aus Oberachmann wird als Gemeinde-Vertragsbediensteter aufgenommen.
- 10.2.1956: Beim Seehof in Litzlberg kommt es zu einem Brand.
Da die Temperatur -28° betrug, war nur durch den Einsatz der Vorbaupumpe die Brandbekämpfung möglich. Sobald die Pumpen zum Stillstand kamen, fror sofort das Wasser in den Armaturen und Schläuchen. - 27.3.1956: An der bestehenden Raiffeisenkasse wird eine Wechselstube angeschlossen.
- 3.6.1956: Gründung des Wasserschiklubs Seewalchen a.A.
- 24.6.1956 Einweihung der Notkirche in der Rosenau durch Superintendent Wilhelm Messing-Braun.
- Im August 1956 übernimmt Hermann Prüher die bisher von der Familie Krottendorfer geführte Gemischtwarenhandlung (Kirchenplatz 1, das Geschäft besteht bis 1985).
- 1.8.1956: Die Pfarre erhält P. Michael Rauh als Kooperator. Es ist sein erster Posten.
- Im Bundesstaat Österreich wird die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und in der Gemeinde gelangt erstmalig der Jahrgang 1937 zur Musterung und zwar 17 Stellungspflichtige.
- 25.8.1956: Christine Häupl sucht um die Konzession für das Gast- und Schankgewerbe in Litzlberg an. Die Gemeinde befürwortet dies und meint, dies sei von besonderer Bedeutung, nachdem die Gaststätte „Seehof Litzlberg“ geschlossen wurde.
Dem Ankauf des Seehofes hat die Landesregierung nicht zugestimmt. Zur Sicherung eines Badeplatzes verlangt die Gemeinde, dass bei einem Abverkauf der Liegenschaft Seehof der öffentliche Zugang zum See aufrecht bleiben muss. - 4.12.1956: Hans Lederer pachtet die Gemischtwarenhandlung in der Seyrlstraße 13 (Margarete Rohleder).
- Im Jahre 1956 bezieht die Firma Kastinger das Fabriksgebäude in der Steindorfer Straße.
- Im Jahre 1956 wird der Ruderverein als Sektion des SK Kammer gegründet.
- 1956 beginnt Rudolf Stallinger, Pettighofen 15, seine Tätigkeit als Fuhrunternehmer (bis 1994).
1957
- 1.1.1956: Rund 2,7 ha Grund (Siedlung Lenzing-Neubrunn) kommen von der Gemeinde Seewalchen zur Gemeinde Lenzing).
- 10.5.1957: In Kraims bricht in den Häusern 5 (Danter) und 9 (Lacher) durch Brandlegung ein Brand aus.
Ein Hilfsarbeiter aus St. Georgen, der in derselben Nacht noch 3 Landwirtschaftsanwesen in Egning, Gemeinde Gampern, angezündet hatte, wurde entlarvt und zu 15 Jahren Kerker verurteilt. - 11.5.1957 In der Gemeindeausschuss-Sitzung wird
- anstelle von Ignaz Rosenauer Max Kastinger zum 2. Vizebürgermeister gewählt.
- das Ansuchen des Michael Emrich um Konzession für eine Flaschenbierschenke einstimmig unterstützt.
- der Straßenbezeichnung und der Hausnummerierung in Seewalchen und Rosenau zugestimmt.
Zu diesem Zeitpunkt hatten rund 250 Häuser sogenannte Konskriptionsnummern. Dazu wird ein Ausschuss bestellt und Johann Köstler zu seinem Obmann gewählt.
Im März 1958 werden die Bezeichnungen bescheidmäßig an die Häuser zugestellt.
Siehe auch Straßen in Seewalchen.
Strandbad Seewalchen
- Im Winter 1955 stand das ehemalige Hasse-Bad (auch Neuhofer-Bad genannt) zum Kauf.
Am 18.2.1955 wurde im Gasthaus Häupl eine überaus stark besuchte Veranstaltung zum Thema „Braucht Seewalchen ein Bad - ja oder nein?“ abgehalten. Fremdenverkehrsobmann Erich Soupper, Bgm. Gebetsberger und Kammerrat Liessbauer aus Hallstatt gaben die gewünschten Aufklärungen zu diesem Thema.
Laut Finanzierungsplan war der Ankauf einiger Grundstücke an der Promenade samt Finanzierung mit Gesamtkosten von rund 1,44 Mio. S. vorgesehen. Der Betrag sollte durch Erhöhen der Hebesätze bei den Steuern sowie durch Fremdenverkehrsmittel erbracht werden
Von den 500 Anwesenden, größtenteils Bauern, wurde festgestellt, dass für Seewalchen ein Bad notwendig sei, aber nicht zu jedem Preis. Im besonderen wandten sie sich gegen die Steuererhöhungen. Nach einer sehr lebhaften Debatte wurde ein Expertenkomitee gebildet, welches weitere Verhandlungen mit den zuständigen Stellen führen sollte. - Im Dezember 1955 bildete sich ein Badausschuss und nach eingehenden Beratungen wurde dem Gemeindeausschuss der Ankauf des Neuhofer-Bades und die Errichtung eines Strandbadneubaues empfohlen. Der erforderliche Seegrund wurde von der Finanzverwaltung, der Verwalterin des öffentlichen Gutes, gepachtet.
So hat der Gemeinderat den Ankauf des Neuhofer-Bades um S 175.000,-- beschlossen und das Bad nach den Plänen von Arch. Otto Frisch, Attnang, zu errichten. - Der Spatenstich fand am 17.6.56 statt. Die Gesamtkosten wurden mit 3,1 Mio. S. veranschlagt.
Die frühere Bad- und Bootvermietung wurde abgetragen. Die Wiese wurde durch Baggerung und Aufschüttung am Seeufer ausgeglichen, wodurch ein Fläche von 3000 m² entstand. Weiters wurden 100 Kabinen, ferner ein Sprungturm mit 10 m Höhe errichtet. Der Fassungsraum beträgt 2000 Personen. Dem Strandbad wurde eine Bootsvermietung, ein Strandbadbuffet sowie ein Raum für Wasser-Ski-Klub und -Schule angeschlossen. - Im Mai 1957 wurde bereits das Buffet des Strandbades (an Irmentraud Lux) verpachtet, ein Bademeister vom 1. Juni bis 1. Oktober angestellt (Rupert Klingler) und eine Tarifordnung beschlossen: Der Preis betrug zum Beispiel für eine halbtägige Wechselkabine: S 2,--; die Parkplatzgebühr:betrug für ein Auto S 3,--.
- Am 21.7.1957 eröffnete Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner im Rahmen einer Feier das neugebaute Strandbad in Seewalchen.
________________________________________________________________________________________________________
- 17.8.1957: Gottlieb Oberndorfer sucht um die Konzession der Milchtrinkhalle im Kleinmüllergarten an (Eingang Promenade – heute Blumengeschäft Mayer).
- Das evangelische Pfarramt schlägt vor, die Bahnhaltestelle „Siebenmühlen-Rosenau“ zu bezeichnen. (Dies wurde erst 1990 verwirklicht.)
- Nachdem Schuldirektor Martin Wehinger in den Ruhestand getreten ist, wird Oberlehrer Anton Schmoller zum neuen Volksschuldirektor bestellt.
- Der Gemeinderat beschließt die Übernahme der Erhaltungskosten für den Güterweg Reichersberg, da er durch seine Verkehrsbedeutung nicht mehr als Interessentenweg angesehen werden kann.
- 1957 wird der Kellerwirt Franz Kroiß zum Obmann der Dilettanten Theatergesellschaft gewählt.
1958
- Im Jahre 1958 beginnt die Fa. Aigner ihren Möbelbetrieb groß auszubauen.
- 13.1.1958: Fritz Neuhofer eröffnet seine Bäckerei in der Hauptstraße 14. (bis 1984)
- Ab März 1958 führt die Familie Lederer eine Gemischtwarenhandlung (Hauptstraße 34). Nach 1970 übersiedelt der Betrieb in die Hauptstraße 8 (vormals Hinterholzer, bis 1990).
Das Geschäft in der Seyrlstraße wird dann von Margarethe Rohleder geführt. - 26.4.1958: Heinrich Rohringer, Hauptstraße, hat die Zustimmung des Gemeinderates zur Errichtung eines Cafehauses erhalten (bisher nur Cafékonditorei).
- 11.5.1958: Grundsteinlegung der evangelischen Kirche in der Rosenau.
- 18.6.1958: Burgschauspieler Raoul Aslan stirbt auf der Insel Litzlberg.
- 6.7.1958: Die Familie Schwarzenlander in Neubrunn eröffnet ein Gasthaus.
- 2.8.1958: Infolge Blitzschlag brennt das Anwesen des Alois Hemetsberger, Schein in Neißing, ab. Das Wirtschaftsgebäude wird zur Gänze und vom Wohntrakt das Dach zerstört.
- 22.8.1958: Ignaz Stiefsohn übernimmt die „Andorfer-Bäckerei” in der Hauptstraße 12.
- 23.8.1958: Walter Pitter wird zum Leiter der Volksschule berufen.
- 6.10.1958 Eröffnung des Pfarrsaales, der an Stelle der Wirtschaftsgebäude errichtet wurde.
- Am 5.12.1958 sind im Wirtschaftsgebäude des Ludwig Six, Reichersberg infolge Erhitzung des Grummetstockes 25 Fuhren Grummet verbrannt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr kann weiterer Schaden verhindert werden.
- Im Jahre 1958 befasst sich der Gemeindeausschuss in mehreren Sitzungen mit dem Bau eines Kindergartens.
- Die LAWOG-Anlage Anton-Peyr-Straße wird im Rohbau errichtet.
Die allgemeine Wohnungsnot
hat auch die Gemeinde Seewalchen zu einschneidenden Maßnahmen gezwungen und den finanziellen Möglichkeiten entsprechend für teilweise Abhilfe zu sorgen.
Trotzdem von 1950-1955 [1950: J.-Wimmer-Straße, 1955: Roseggerstraße] neben den Siedlungsbauten in Seewalchen und privaten Bauten in der Gemeinde über 100 Objekte neu errichtet wurden, hat sich die Gemeinde genötigt gesehen, um den größten Nöten abzuhelfen, auch aus eigenem zur Hilfeleistung einzuschreiten.
So wurde bereits 1950 an der Einbiegung der Haidacher- und Siebenmühlenstraße ein Wohnbarackenbau Nr. 242 zur Unterbringung für mehrere Parteien errichtet.
Weiters wurden 1952 zwei Häuser im Waldweg erworben und für Mehrwohnungen umgebaut.
Vorrübergehend wurde eine Familie im Sitzungssaal der Gemeinde untergebracht. „Der Bürgermeister zog sich mit seinen Leuten ins Feuerwehrdepot zurück“, las man in der Zeitung „Der Stern“. „Seewalchen ist stolz auf seinen Bürgermeister: Seine Ideen sind gut - auch ohne Gemeindesaal“.
________________________________________________________________________________________________________
1959
- 27.1.1959: Der Gemeinderat beschließt den Ankauf des Badeplatzes Litzlberg.
- 2.2.1959: Alois Ulm übernimmt die ehemalige Hüttmayr-Bäckerei (Hauptstraße 9) (bis 1975).
25.4.1959: Es wird beschlossen, den Knäulberg (=Reichersberger Straße), die Promenade und den Schulweg staubfrei zu machen.
Hochwasser
Frühjahr und Sommer 1959: Starke Regenfälle verursachen Hochwasser.
Am linken Atterseeufer in Kammer und Seeberg vermurt ein großer Erdrutsch die Bundesstraße. Ein Teil der Fahrbahn bei Seeberg wird in den See geschoben. Der Verkehr nach Weyregg ist unterbrochen.
Versuche eine Notstraße zu errichten, scheiterten. Schließlich wurde die Straße am 2. August gänzlich gesperrt. Zum Transport der Fahrzeuge musste vom 8.9.-17.10. eine Motorplätte die Überfuhr übernehmen.
Auch bei Unterbuchberg kommt es zu Hangrutschungen.
Der See war über 1 m höher als normal.
- 3.9.1959: Die Müller-Villa wird von der Gemeinde um S 850.000,-- angekauft. Die Gesamtfläche beträgt 4381 m². Dazu wird ein Darlehen von S 500.000,-- bei der Raika Seewalchen aufgenommen.
- Durch die im September 1959 einsetzende Trockenheit versiegen Quellen, sodass in vielen Ortschaften Wassermangel entsteht. Die Trockenheit dauert bis zum Einbruch des Winters anfangs Dezember.
Einweihung der Kirche Rosenau
Am 31.10.1959 wird die Gnadenkirche in der Rosenau durch Bischof Dr. Gerhard May feierlich eingeweiht.
Am 11.5.1958 erfolgte die Grundsteinlegung, bereits am 5.Oktober 1958 feierte man das Richtfest.
________________________________________________________________________________________________________
1960
- 8.3.1960: In der Bar des Hotels Häupl kommt es durch eine weggeworfene Zigarette zu einem Brand.
- 23.4.1960: Die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters beträgt S 4,40 je Einwohner, das sind S 14.598,-- jährlich.
- Für die Volksschule werden 25 Kufenschultische und 50 Kufenschulsessel samt Lehrermobilar zum Preis von S 15.944,-.
Weiters wird als Schulfunkgerät ein Radio mit Plattenspieler (Hornyphon Musikmeister) bei Anna Wedl, Seewalchen, zum Preis von S 3.500,-- angekauft. - In den 1960er Jahren ist Paul Freudenthal Obmann des Fremdenverkehrsverbandes.
- 29.6.1960: In Basel verstirbt der Ehrenbürger Prof. Dr. Karl Häupl.
- 16.7.1960: Der Gemeinderat genehmigt den Vertrag mit dem Ruderclub Seewalchen wegen Benützung des gemeindeeigenen Grundstückes im Bereich der Müller-Villa.
- 17.7.1960: Die Arbeiten der Turmhelmreparatur der Pfarrkirche werden abgeschlossen. Kugel und Kreuz werden neu vergoldet.
Autobahnbau
1958 wurde als erstes Teilstück der Autobahn die Strecke Salzburg-Mondsee dem Verkehr übergeben.
Im August 1960 wurden in Seewalchen die Arbeiten an der Autobahn wieder aufgenommen.
Die zweite Autobahnunterführung (nordöstlich der Frickh-Kapelle) wurde vom 5.-8. April 1961 gesprengt, da sich die Trassenführung gegenüber den Plänen der „Reichsautobahn“ etwas geändert hatte.
Die Häuser „Buchberger“ [Werner Schneider] und „Kratzer“ (sie waren durch das gesprengte Viadukt erreichbar), sowie „Moser“, Hatschekstraße 19 wurden abgerissen.
Frau Buchberger konnte das Haus Seyrlstraße 5, Frau Moser das Haus Promenade 3 erwerben.
Im Bereich der Abfahrt wurden die Häuser und Liegenschaften Leiß, Wendl und Schaurecker eingelöst. Somit fielen insgesamt 3 landwirtschaftliche Betriebe und 7 Wohnhäuser dem Autobahnbau zum Opfer.
Am 15.6.1963 wurde Richtung Regau eine Richtungsfahrbahn, am 31.7.1963 Richtung St. Georgen eine Richtungsfahrbahn für den Verkehr freigegeben.
Am 24. Juli 1965 waren die Arbeiten im Bereich Seewalchen abgeschlossen.
Mit dem Autobahnanschluss entstanden in Seewalchen mehrere Tankstellen, Neben der seit ca. 1925 bestandenen Tankstelle Lenzenweger (später Mobil, dann BP) wurden eine Esso-Tankstelle (Atterseestraße 50), eine ARAL-Tankstelle (Atterseestraße 45a, später China-Restaurant) und eine Shell-Tankstelle (Atterseestraße 33, Liehmann) neu errrichtet.
Aral schloss 1980, Shell 1997 und BP-Lenzenweger 2000 ihren Tankstellenbetrieb.
________________________________________________________________________________________________________
- 13.11.1960: In der Sakristei der Pfarrkirche Seewalchen entsteht durch fahrlässige Aufbewahrung der Rauchfasskohle ein Brand, bei dem die gesamte Einrichtung und die untergebrachten Gegenstände vernichtet werden. Der Schaden beträgt S 70.000,--.
- Im November 1960 wird in Kraims (Brunnbergstraße) ein Taxilenker ermordet.
- Die zeitlich beschränkte Gasthauskonzession von Cäcilia Purner, Steindorf (Gamperner Straße) soll erweitert werden, (um gerade den Arbeitern der Autobahnfirmen in der kalten Jahreszeit die Einnahme eines warmen Essens zu ermöglichen).
- 12.12.1960: Die Handels- und Gewerbebank Vöcklabruck errichtet in der Hauptstraße 40 (Haus Moser) eine Filiale.
- Im Jahre 1960 übersiedelt Hedy Lachinger mit ihrem 1951 gegründeten Betrieb in das neue Haus in der Hauptstraße 25..
- Anfang der sechziger Jahre schließt die Wagnerei Lassl (Kapellenweg 8) ihren Betrieb.
Rechnungsabschluss der Gemeinde 1960: Einnahmen: 2,493 Mio. S Ausgaben: 1,985 Mio. S
Quellen
- Chronik der Marktgemeinde Seewalchen
- Diverse Chroniken und Festschriften von Vereinen
- Sitzungsprotokolle des Gemeinderates und Gemeindeausschusses
- Ergänzende Zeitungsartikel
- Seewalchner Marktblatt
- Gemeindezeitungen: Seewalchner Gemeindebote, Seewalchen aktuell
- Adolf Bocksleitner: Seewalchen am Attersee, ein Heimatbuch; Verlag Julius Wimmer, Linz, September 1929
- Hans Dickinger: Geschichte von Schörfling, Marktgemeinde Schörfling am Attersee, 1988
- zusammengestellt bis 2021 von Johann Rauchenzauner
- zusammengestellt ab 2021 von Johann Reiter